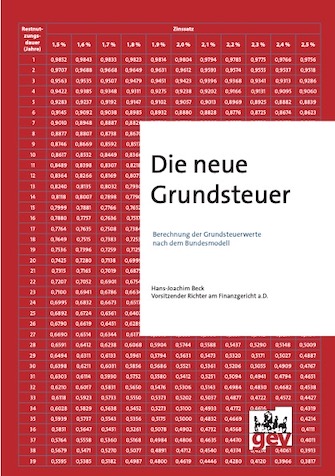Archiv / Suche
Und die Rechnung kommt am Schluß: Die Sanierungsausgleichsabgabe
13.09.2004 (Unveröffentlichte Langversion des Beitrags GE 17/04, Seite 1075 ff.) Zur zweifelhaften Praxis der Berliner Bezirksämter und dem Begriff „sanierungsbedingt„ im Rahmen des Sanierungsausgleichsbetrags
Lesen Sie zu diesem Thema auch Bischoff in GE 17/04, Seite 1075 ff.
In Folge der Aufhebung vieler Sanierungsgebiete im Westen und des zunehmenden Sanierungsgrades im ganzen Ostteil Berlins wird den betroffenen Eigentümern derzeit zunehmend die letzte unangenehme Konsequenz eines Sanierungsgebiets deutlich: Der Sanierungsausgleichsbetrag gem. § 154 BauGB. Nach dieser Vorschrift hat der Eigentümer eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks zur Finanzierung der Sanierung einen Ausgleichsbetrag in Geld an die Gemeinde zu entrichten, der der „durch die Sanierung bedingten„ Erhöhung des Bodenwerts seines Grundstücks entspricht. Gem. § 154 Abs. 2 BauGB besteht diese Bodenwerterhöhung aus dem Unterschied zwischen dem Bodenwert, der sich für das Grundstück ohne Beabsichtigung und Durchführung einer Sanierung ergeben hätte (Anfangswert) und dem Bodenwert, der sich in Folge der tatsächlichen und rechtlichen Neuordnung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes ergibt (End- oder Neuordnungswert).
Dieser Beitrag konzentriert sich vor diesem Hintergrund auf einzelne Fragestellungen, so daß ergänzend die grundsätzlichen Ausführungen z.B. bei von Seldeneck/Dyroff, GE 2/99 S. 89 ff. herangezogen werden können. Die Schwerpunktproblematik des Beitrags, der Begriff „sanierungsbedingt„ als Abgrenzungskriterium zwischen ausgleichspflichtigen Werterhöhungen und der allgemeinen Wertentwicklung ist allgemein, in den neuen Bundesländern und dem Ostteil Berlins aber ist sie besonders dringlich.
I. Aktuelle Entstehung des Ausgleichsbetrags in den östlichen Bezirken Berlins – Warum ein vorzeitiger Abschluß sinnvoll sein kann
Gem. § 154 Abs. 3 BauGB ist der Ausgleichsbetrag nach Abschluß der Sanierung zu entrichten. Zwar ist offenkundig noch kein Sanierungsgebiet in den östlichen Bezirken aufgehoben worden, so daß ein Abschluß nach § 162 BauGB (Aufhebung des gesamten Gebietes durch Satzung) nicht in Betracht kommt. Auf Antrag des Eigentümers hat die Sanierung aber gem. § 163 Abs. 1 BauGB für dessen Grundstück als abgeschlossen erklärt zu werden, wenn entsprechend den Zielen und Zwecken das Grundstück bebaut ist oder in sonstiger Weise genutzt ist oder das Gebäude modernisiert oder instand gesetzt ist. Im Standardfall eines sanierten Altbaus besteht also nach Abschluß der baulichen Maßnahmen regelmäßig ein Rechtsanspruch auf eine vorzeitige Entlassung. Mit der Abschlußerklärung entfällt die Anwendung der §§ 144, 145 und 153 BauGB, also die umfassende Genehmigungsbedürftigkeit zahlreicher Vorgänge (§ 144 BauGB) und die Kaufpreisprüfung gem. § 153 Abs. 1 und 2 BauGB, die Eigentümer im Sanierungsgebiet sonst behindern. Dazu zählen insbesondere die Genehmigungspflicht für Mietverträge auf bestimmte Zeit von mehr als einem Jahr (§ 144 Abs. 1 Nr. 2) und „erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs- zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind„ (§ 144 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 14 Abs. 1 BauGB). Die allen Betroffenen hinlänglich bekannten Behinderungen und Verzögerungen, die eine notwendige Sanierungsgenehmigung (ggf. neben der allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Prüfung) mit sich bringt, können so beseitigt werden. Für künftige Verkaufsfälle besteht eine bessere Verkäuferposition und störende Verzögerungen durch die Kaufpreisprüfung werden vermieden. Bei korrektem Vorgehen der Verwaltung wird die verfrühte Zahlung durch Abzinsung des auf noch nicht erreichte Fortschritte entfallenden Teils des Ausgleichsbetrags sowie durch so genannte Pionier- und Wagnisabschläge reduziert.
II. Ermittlung des Ausgleichsbetrages bei der vorzeitigen Entlassung
1. Grundsätzliches zum „Berliner Modell„
Klargestellt sei vorab, daß Rechtsgrundlage für die Berechnung auch des vorzeitig festgesetzten Ausgleichsbetrags die §§ 152-155 BauGB sind. Für die Gerichte verbindliche gesetzliche Vorgaben ergeben sich hieraus, nicht dagegen aus verwaltungsinternen Regeln. Daher ist die Rechtmäßigkeit der gegenwärtigen Verwaltungspraxis am Gesetz und nicht am Maßstab der AV-Ausgleichsbeträge vom 12.11.2002 (ABl. 2003, S. 1761), als der einschlägigen Handlungsanweisung der Berliner Senatsverwaltung zu prüfen. Jedoch kann sich der einzelne Betroffene auf ihn begünstigende Regelungen der AV-Ausgleichsbeträge insoweit berufen, als diese eine „Selbstbindung der Verwaltung„ herbeiführen. Denn es wäre mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbart, wenn die Masse der Verfahren nach der AV abgewickelt würde, dort wo es der Verwaltung günstig erscheint, aber abgewichen wird.
Maßgeblicher Schritt der Ausgleichsbetragsermittlung ist die Ermittlung der „sanierungsbedingten Bodenwertsteigerung„, also der Differenz zwischen Anfangs- und Endwert. Wie von von Seldeneck/Dyroff in GE 1999, S. 92 ff. dargestellt, bedienen sich die Berliner Behörden dabei einer bestimmten Form der „Komponentenlösung„, nämlich dem „Zielbaumverfahren„. Hieran hat sich durch die neuen AV-Ausgleichsbeträge grundsätzlich nichts geändert. Die Bezirksämter stufen dabei mittels eines Klassifikationsrahmens den Zustand eines Grundstücks vor und nach der Sanierung für verschiedene als wertmaßgeblich ermittelte Komponenten (etwa Bebauungsdichte, Ausstattung der Wohnungen, Stadtbild) ein. Die Zustände werden dazu jeweils mit Noten von 1-5 bewertet. War z.B. zu Beginn der Sanierung eine „erhebliche Beeinträchtigung der Wohn und ggf. Arbeitsverhältnisse„ durch die Bebauungsdichte gegeben, bedeutet dies beim „Lagekriterium 2 - Bebauungsdichte„ Note 4. Ist die Beeinträchtigung am Ende nur mehr „mittelschwer„, führt dies zur Note 3. Die Noten bei den einzelnen Lagekriterien werden dann mit Hilfe des Zielbaums zu einer Gesamtnote zusammengefaßt. Je nach (angeblicher) Wichtigkeit einer Komponente gibt der Zielbaum der entsprechenden Note ein bestimmtes Gewicht mit dem sie in die „Gesamtnote„ einfließt. Als Ergebnis des Zielbaums ergeben sich damit 2 „Durchschnittsnoten„. Eine für den Zustand im Anfangszeitpunkt und eine für den Zustand im Endzeitpunkt der Sanierung.
2. Differenzwertbildung mit Anfangswert und Multiplikator
Die Differenz, also die „Notenverbesserung„ wird dann in einen „Multiplikator„ umgerechnet. Dieser Multiplikator wird anschließend auf den außerhalb dieses Verfahrens ermittelten Bodenwert vor oder auch nach Sanierung angesetzt. Von Seldeneck/Dyroff gehen in ihrer Darstellung davon aus, daß ein Endwert vorhanden ist, bzw. außerhalb o. g. Verfahrens (durch den Gutachterausschuß) festgelegt wurde und dann ein Multiplikator kleiner 1 zur Ermittlung des Anfangswerts führt. Bei der vorzeitigen Entlassung jedoch sind zum maßgeblichen Zeitpunkt noch keine allgemeinen Endwerte ermittelt. Üblicherweise wird auch behauptet, es fänden sich nicht ausreichend ähnliche Verkaufsfälle, die eine individuelle Ermittlung im Vergleichswertverfahren ermöglichen würden. Daher wird auf die „Anfangswerte„ zurückgegriffen, die sich in den Bodenrichtwertkarten für die östlichen Sanierungsgebiete finden. Dies sind vom Gutachterausschuß mit den allgemeinen Änderungen der Wertverhältnisse fortgeschriebene Werte vom Sanierungsbeginn. Grob gesagt wird durch die Bezirksämter die (nach deren Auffassung) eingetretene Notenverbesserung in einen Faktor größer 1 umgerechnet. Dieser wird dann auf den Ausgangswert angesetzt, so daß sich der (fiktive) Endwert durch Multiplikation ergibt. Die Differenz wird als Ausgleichsbetrag erhoben.
Maßgeblich für den Endwert ist also insoweit der durch den Zielbaum und weitere Rechenschritte, die aber nur mehr den „Maßstab„, nicht die inhaltliche Richtung ändern, ermittelte „Multiplikator„. Ist dieser größer 1, so ergibt sich zwangsläufig
Endwert (= Anfangswert * Anfangswertmultiplikator) ist größer als Anfangswert
Der Multiplikator berechnet sich dabei nach der Formel
(1 – (0,25 * Normierte-Zielbaum-Note Endzustand) / (1-(0,25 * Normierte Zielbaum-Note Anfangszustand)
Nur wenn auch die rechtliche Situation des Grundstücks neu geordnet wurde (v. a. wenn eine höhere GFZ/bauliche Ausnutzung neu zulässig wird), kommt hierfür ein Ansatz hinzu. Beim Regelfall der östlichen Sanierungsgebiete ist dies nicht einschlägig. Vermindern kann sich der Ausgleichsbetrag noch durch einen in Folge aufstehender Bebauung eingeschränkten Nutzen aus der Bodenwerterhöhung („rentierlicher Bodenwertanteil„). Diese unten erläuterte Minderung ist aber eine prozentuale, die wie die sonstigen Rechenschritte allenfalls den Maßstab, nicht aber die Richtung ändert.
Mithin gilt, daß zumeist allein die Höhe der Durchschnittsnoten des Anfangs- und Endzustands, also die Summe der getroffenen Zustandseinschätzungen, die Bodenwerterhöhung bestimmt.
3. Maßnahmebodenwert und abgezinster Endwert
Bei der vorzeitigen Entlassung ergibt sich eine weitere Besonderheit: Da der „Endzustand„ mangels Abschluß der Sanierung noch nicht erreicht ist, kann die Endqualität nur prognostiziert werden. Die Verwaltung tendiert bei sich wehrenden Eigentümern dazu, das Schwergewicht auf solche künftige Verbesserungen zu legen. Denn wie gut oder schlecht der Zustand zum Zeitpunkt der Entlassung ist, kann durch tatsächliche Feststellungen überprüft und bewiesen werden. Die Endzustandsprognose ist weit schwieriger anzugreifen. Gleichwohl sollten etwa überzogene Prognosen nachhaltig hinterfragt werden. Denn es ist mittlerweile sogar fraglich, ob die Sanierung in den östlichen Bezirken nicht unvollendet abgebrochen wird, so daß überhaupt keine weitere Entwicklung berechnet werden dürfte: Im Mietermagazin Juni/Juli 2004 („Vor der Sanierung ist nach der Sanierung„) wird von Plänen der Senatsverwaltung berichtet, wegen Geldmangels die Sanierungsgebiete im Ostteil bereits 2005 oder 2006 aufzuheben. Dann wäre dieser „Endzustand„ anzusetzen.
Jedenfalls darf der Endzustand nicht unvermindert in Rechnung gestellt werden, da er ja erst später erreicht wird. Methodisch tritt daher zwischen den Ausgangs- und den Endwert ein sogenannter „Maßnahmebodenwert„:
Dazu werden 3 „Durchschnittsnoten„ ermittelt. Eine für den Anfangszustand, eine für den Zustand im Zeitpunkt der Entlassung (z.B. 2000) und eine für den (prognostizierten) Zustand im Zeitpunkt des allgemeinen Sanierungsabschlusses. Die Differenz zwischen dem nach obigem Muster per Multiplikation auf den Anfangswert ermittelten „Maßnahmebodenwert„ und dem Anfangswert wird 1 zu 1 in Rechnung gestellt. Die ebenso berechnete Differenz zwischen dem prognostizierten Endwert und dem Maßnahmebodenwert wird über die sogenannte „Wartezeit„ bis zum Erreichen des Endzustands (Aufhebung der Sanierungssatzung) abgezinst. Der Zinssatz beträgt nach der aktuellen AV-Ausgleichsbeträge 5 % p. a. Es ergibt sich daher die auszugleichende Bodenwertsteigerung mit:
(Maßnahmebodenwert – Anfangswert) + (Endwert – Maßnahmebodenwert) x 1/1,05 hoch Wartezeit
Der Satz von 5 % liegt nach Auffassung des Verfassers mittlerweile in den meisten Fällen unter dem Liegenschaftszinssatz des betreffenden Grundstücks und ist unzureichend. Würde die Vollziehung ausgesetzt, berechnete Berlin 6 % Zinsen, also mehr, als man zugunsten der Eigentümer ansetzt. Unabhängig von der Zinssatzhöhe gilt indes: Je größer die Wartezeit, um so stärker wirkt sich die Abzinsung aus. Selbst wenn also die Sanierungsgebiete bis zur Zielerreichung zu Ende geführt werden, fragt sich bis wann. Die Verwaltung prognostiziert derzeit den Endzeitpunkt auf einen Zeitpunkt, zu dem die Sanierung in Wahrheit nicht erfolgreich abgeschlossen sein kann, für das Sanierungsgebiet Kollwitzplatz z.B. auf 2010. Doch wurde in Berlin noch nie ein Sanierungsgebiet innerhalb von 17 Jahren festgesetzt und wieder aufgehoben, die von Sanierungsgeldern bezahlte Zeitschrift „VorOrt„ stellte bereits 1998 fest: „Die Aussagen der Verantwortlichen zu den weiter notwendigen Maßnahmen und den Finanzproblemen mit der daraus resultierenden Streckung der Entwicklung deuten eine Aufhebung nicht vor 2020 an.„
Der Unterschied ist beträchtlich: Wird der Endwert (bei Entlassung im Jahr 2000) in 2010 erreicht, so ist mit 1,05 hoch 10 abzuzinsen, die Wertdifferenz also durch 1,63 zu teilen. Wird der Endwert entsprechend der tatsächlichen Geltungsdauer aller bisher in Berlin aufgehobenen Sanierungssatzungen erst 2023 erreicht, so ist mit 1,05 hoch 23 abzuzinsen, wonach die Wertdifferenz durch 3,7 zu teilen ist.
Der „Endzustand„ bzw. der Ausgleichsbetrag sind zudem um einen Wagnis- und Pionierabschlag zu mindern. Der Wagnisabschlag betrifft die Gefahr, daß die Prognose nicht eintritt und muß um so höher sein, je unvorsichtiger diese ist. Der Pionierabschlag berücksichtigt, daß der bereits entlassene Eigentümer (der also sein Haus schon für viel Geld saniert hat) diese Investition zunächst nur eingeschränkt nutzen kann, da ihn die negativen Folgen der andauernden Sanierung (Baulärm…) behindern. Beides übersehen die Berliner Behörden häufig, obwohl sie nach BVerwG 4 C 6.01 vom 16.05.2002 (BauR 2002 S. 1811) zur Berücksichtigung verpflichtet sind.
4. Ausgleichsabgabe trotz gesunkener Bodenwerte
Gerade in den östlichen Bezirken sind die Grundstücke heute im Regelfall weniger wert, als zu Beginn der Sanierung. Bei der dargestellten Berechnung, die den Endwert durch Multiplikation auf den Anfangswert errechnet, kommt es aber zwangsläufig zu einer „Werterhöhung„. Dies ist im Grundsatz gesetzessystematisch korrekt, da der „Anfangswert„ wie nachfolgend zu erläutern ist, ein fiktiver Wert im Zeitpunkt des Abschlusses der Sanierung ist, und nicht etwa mit dem tatsächlichen (Nominal)wert zum Beginn der Sanierung gleichgesetzt werden darf.
5. Kritik am Zielbaum
Wie erläutert nimmt der „Zielbaum„ zum einen eine Gewichtung der verschiedenen Noten vor, was einer eingeschränkten gerichtlichen Überprüfung unterliegt, da es unmöglich ist, genau „die„ exakt richtige Gewichtung der Wertkomponenten vorzunehmen. Dennoch erscheint es rechtlich unhaltbar, daß für alle innerstädtischen Bezirke Berlins ein und derselbe Zielbaum gelten soll. Für ein x-beliebiges Grundstück im Sanierungsgebiet Winsstraße sollen die gleichen Kriterien in gleichem Umfang wertrelevant sein, wie etwa in Kreuzberg. Kultureinrichtungen im Sanierungsgebiet selbst sollen für einen zentrumsfernen Straßenzug nicht wichtiger sein, als für ein Grundstück, von dem aus man in kürzester Zeit zu Fuß zentrale Kultureinrichtungen wie die deutsche Oper oder die Museumsinsel erreicht. Dies ist offensichtlich unzutreffend und übersteigt m. E. den behördlichen Beurteilungsspielraum, da eine „Beurteilung„ im Einzelfall gar nicht erst stattfindet. Es wird eine offenkundig stark heterogene Masse Tausender von Grundstücken, verteilt über ein Stadtgebiet mit hunderttausenden von Grundstücken über einen Kamm geschoren.
Zudem legt der Zielbaum fest, welche Kriterien überhaupt als wertrelevant erfaßt werden. Und hier sind äußerste Zweifel angebracht, daß tatsächlich nur empirische Beobachtungen umgesetzt wurden. Denn politisch unerwünschte Wertkomponenten wie etwa der Anteil an Sozialwohnungen oder sonst subventionierten Wohnungen, das Bestehen von Mietobergrenzen und Belegungsbindungen sowie die Sozialstruktur der Bewohner werden nicht erfaßt. Dabei dürfte sich empirisch ein sehr starker Zusammenhang dahingehend zeigen, daß ein hoher Anteil an Sozialwohnungen oder sonst „preisbeeinflußten„ Wohnungen der gegenwärtigen Förderart zu niedrigeren Grundstückswerten führt. Soweit von Seldeneck/Dyroff auf das werterhöhende Moment der Wohnungsbauförderung hingewiesen haben, galt dies ersichtlich der seinerzeitig üppigen Förderpraxis, die Stadtvillen in Lichtenrade und selbst Dachgeschoßausbauten in Weißensee förderte, wenn sich der Vermieter nur zu einer Miete von maximal 10 Euro/m² verpflichtete. Auf die nunmehr gänzlich geänderte Förderpraxis bzw. die „soziale Stadterneuerung„ mit Mieten von 3 Euro/qm ist dies nicht übertragbar. Eine schwache Sozialstruktur (niedriges Durchschnittseinkommen) der Bewohner dürfte die mit den Grundstückswerten am stärksten korrelierte veränderliche Komponente sein. Doch da die Sanierungspolitik bewußt darauf ausgerichtet war, den Anteil an sozialgebundenen Wohnungen zu erhöhen und die Bewohnerstruktur vor Verdrängung zu schützen, ergäbe ein Einbezug dieser Kriterien negative „sanierungsbedingte Wertveränderungen„, würde man die Entwicklung ohne Sanierung mit der Entwicklung mit Sanierung i. S. der städtebaulichen Veranstaltung vergleichen. Ihr Weglassen dient fiskalisch politischen Zwecken, ist empirisch und damit rechtlich jedoch unhaltbar.
Dabei geht es mitnichten darum, zu bezweifeln, daß der Erhalt bestehender Bewohnerstrukturen und günstigen Wohnraums ein legitimes Politikziel sein kann. Doch bei dem Sanierungsausgleichsbetrag geht es allein um die finanzielle Frage einer Grundstückswerterhöhung. Im Hinblick auf die Sozialpflichtigkeit des Eigentums auferlegte Beschränkungen müssen hier Berücksichtigung finden. Verwaltungsvertreter, die allen Ernstes behaupten, Mietobergrenzen seien grundstückswerterhöhend, bedauern vermutlich auch die armen Grundstückseigentümer in New York, deren Grundstückswerte im Umkehrschluß zusammengebrochen sein müßten und glauben, das Mietniveau in den Innenstädten Münchens, Stuttgarts oder Frankfurts führe zur Verelendung der betroffenen Hauseigentümer.
6. Kernpunkt bei den aktuellen Festsetzungen: Der Bewertungsrahmen
6.1. Allgemeines
Abgesehen von diesen fragwürdigen (Nicht-)Wertungen des Zielbaums ist die für den Ausgleichsbetrag entscheidende Stellweiche die „Benotung„ der Zustände. Die Behörden erstellen dazu einen matrixartigen „Bewertungsrahmen„ gem. Nr. 6.5.3. der AV-Ausgleichsbeträge 2002. In diesen wird die zugleich erstellte textliche „städtebauliche Stellungnahme„ übertragen, indem den dort beschriebenen Zuständen „Noten„ zugewiesen werden. Seltsam mutet dabei zunächst an, daß die Beschreibung regelmäßig von Mitarbeitern des Sanierungsbeauftragten (meist BSM oder STERN) erstellt wird. Diese wirtschaftlich orientierten Gesellschaften, die von der Sanierungsbetreuung leben und deren Mitarbeiter darauf angewiesen sind, möglichst oft einen möglichst hohen Sanierungsbedarf festzustellen um diesen dann erfolgreich zu beseitigen, urteilen also über ihre eigene Arbeit. Erfreulicher Weise unterliegen die tatsächlichen Einordnungen in der Bewertungsmatrix voll der Kontrolle durch die Gerichte. Das BVerwG (BVerwG 4 C 6.01 vom 16.05.2002 BauR 2002 S. 1811 = ZfIR 2002, S. 918 – Leitsatz 4) stellt hierzu klar: „Wenn nach allgemeiner Auffassung bei der Bewertung von Grundstücksflächen ein Wertermittlungsspielraum anzuerkennen ist, so beruht dies darauf, daß die eigentliche Bewertung immer nur eine Schätzung darstellen kann und Erfahrung und Sachkunde voraussetzt, über die ein insoweit nicht sachkundiges Gericht weniger verfügt als die Mitglieder der Gutachterausschüsse. Ein derartiger Wertermittlungsspielraum ist jedoch auf diesen Bereich beschränkt. Er erstreckt sich nicht auf die rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen der Bewertung. Ob eine Bewertung auf zutreffenden Voraussetzungen beruht, dürfen die Verwaltungsgerichte in vollem Umfang prüfen; sie müssen es sogar, wenn die Beteiligten darüber streiten.„
Der erste und mitunter wichtigste Ansatzpunkt ist daher kritisch zu überprüfen, ob der tatsächliche Zustand im Anfangszeitpunkt so schlecht war, gegenwärtig (Maßnahmebodenwert) so gut ist und zukünftig (Endzustand) so phantastisch sein wird, wie behauptet.
6.2. Der Begriff „sanierungsbedingt„.
6.2.1. Grundsätze
Dreh- und Angelpunkt für eine Prüfung ist die Eliminierung nicht sanierungsbedingter Änderungen. Wird durch den Gutachterausschuß ein korrekter Anfangswert– also der mit den allgemeinen Veränderungen der Wertverhältnisse fortgeschriebene historische Wert – und auch tatsächlicher Endwert ermittelt, so ist dies zumindest modelltheoretisch sichergestellt. Wird aber nur der Anfangs- oder Endwert zur Grundlage genommen und der jeweils andere fiktiv durch einen „Faktor„ auf diesen berechnet, so ist unabdingbar, daß bei Ermittlung des „Faktors„ über die Komponentenlösung nur solche Veränderungen in den Bewertungsrahmen Eingang finden, die sanierungsbedingt sind.
Wenn also wie im Fall der östlichen Berliner Sanierungsgebiete derzeit ein Aufschlag auf die Anfangswerte zur Endwertermittlung vorgenommen wird, so darf in diesem Aufschlag nichts enthalten sein, was nicht sanierungsbedingt ist. Ein Beispiel: Die Grundstückspreise erhöhen sich allgemein im Zentrum Berlins um 10 %, weil die Luft in Berlin sauberer wird und mehr Menschen aus dem Umland wieder in die Innenstadt ziehen. Diese allgemeine Entwicklung berücksichtigt der Gutachterausschuß, in dem er den „Anfangswert„ entsprechend (z.B. von 1.000 Euro auf 1.100 Euro/m²) erhöht. Wenn aber dann das Bezirksamt die (auch im Sanierungsgebiet eingetretene) Luftverbesserung in sein Komponentenmodell einbezieht, in dem es die Komponente 9 „Luft und Lärmbelastung„ im Anfangszeitpunkt als erheblich (Note 4) und am Ende nur mehr als gering (Note 2) einstuft, so erhöht sich nach o. g. Berechnung über Zielbaum etc. der „Anfangswertmultiplikator„. Wird dieser erhöhte Multiplikator dann auf den (ohnehin durch den Gutachterausschuß erhöhten) Anfangswert angesetzt, so potenziert sich der Effekt im Beispiel zu 1.100 * 1,1 = 1210. Der angebliche „Wertgewinn„ läge also bei 110 Euro/m². Damit ist zugleich eine weitere rechtswidrige Schwäche des „Anfangswertmultiplikators„ aufgezeigt: Die eingetretene „sanierungsbedingte„ Bodenwerterhöhung ist um so größer, je höher die allgemeinen Verbesserungen/Wertänderungen sind. Das Hochindexieren des Anfangswertes durch den Gutachterausschuß, das eigentlich zu Gunsten des Eigentümers verhindern soll, daß er mit externen Effekten belastet wird, erhöht tatsächlich zu seinen Lasten den abzuschöpfenden Wertgewinn.
Will man Entwicklungen, die auch ohne die städtebauliche Veranstaltung „Sanierung„ stattgefunden hätten, gesetzeskonform herausrechnen, so muß das Bezirksamt bei der Notenvergabe für den Anfangszustand nicht den historisch-tatsächlichen Zustand (schlechte Luft) betrachten, sondern den um allgemein eingetretene Veränderungen fortgeschriebenen Zustand (verbesserte Luft) benoten. Denn dies ist der Zustand „der auch ohne Sanierung eingetreten wäre„. Das Bezirksamt müßte also „A„ und „E„ mit Note 2 bewerten. Alle Verbesserungen, für die die Sanierung i.S.d. städtebaulichen Veranstaltung nicht Bedingung waren, müssen bereits beim Anfangswert „gutgebracht„ werden.
6.2.2. Praxis der Bezirksämter in den östlichen Bezirken
Im Ostteil Berlins – so möchte man meinen – läge diese Notwendigkeit wegen der Umbrüche im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung auch für die Behörden auf der Hand. Doch die dortigen Ämter rechnen 100 % der tatsächlichen Veränderungen als sanierungsbedingt in die Festsetzung des Ausgleichsbetrages ein. Die Note für „A„ wird durch unkorrigierte Bewertung des historischen Zustands im gewählten Ausgangszeitpunkt vergeben, die Note für „E„ durch unkorrigierte Bewertung des (prognostizierten) Zustands im Endzeitpunkt. Man hält gleichsam ein Foto von 1990 neben ein Foto von 2010, bewertet beide für sich und berechnet die Differenz. Z.B. im Sanierungsgebiet Kollwitzplatz wird dabei der Anfangswert /Anfangszustand auf den 29.11.1990 festgesetzt, also wenige Wochen nach der Wiedervereinigung. Alles was sich seither bis zum angeblichen Endzeitpunkt 2010 verändert, soll eine sanierungsbedingte Wohltat der Sanierungsverwaltung und damit eine abzuschöpfende sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung sein.
Dabei ist offensichtlich, daß in Folge der Wiedervereinigung der Zustand von 1990 auch ohne Sanierungssatzung nicht unverändert bleiben würde. Kein Gebiet – ob Sanierungsgebiet oder nicht – in den neuen Ländern und dem Ostteil Berlins sieht 2010 so aus wie 1990. Dies ist eine zwangsläufige Folge des grundgesetzlichen Gebotes einheitlicher Lebensbedingungen und der freien Marktwirtschaft. Es lastete tatsächlich ein hoher Investitionsdruck auf den betroffenen Gebieten und nur zur Erreichung der vorrangig „sozialen Sanierungsziele„ (Verhinderung von Mietpreissprüngen, Schutz des angestammten „Milieus„ etc.) wurden die Mittel des besonderen Städtebaurechte benötigt und benutzt. Die Sanierungsverwaltung hat mit Mietobergrenzen, Verzögerungen und Auflagen die wirtschaftliche Entwicklung behindert und Investoren gehemmt. Doch die Sanierungsämter sehen dies anders. Eine Rücksprache mit mehreren Berliner Juristenkollegen bestätigte, daß es allgemeine Praxis ist, 100 % der Zustandsveränderungen auch im Falle des Ostteils Berlins als sanierungsbedingt anzusehen.
6.2.3. Argumentation der Verwaltung - Stand der Rechtswissenschaft
Die Verwaltung stützt sich dabei auf die These, ein Sanierungsgebiet sei ja nur deshalb festgesetzt worden, weil ohne diese Festsetzung keine positive Gebietsentwicklung erwartet hätte werden können. Daher sei alles Geschehene „sanierungsbedingt„. Dabei wird zum einen verdrängt, daß ein Großteil der Festsetzungsbegründungen aus „sozialen„ Zielen bestand: Die vorzunehmende Modernisierung sollte sozial gerecht ablaufen, der freie Markt sollte beschränkt werden. Zum anderen werden Rechtsmeinungen verschiedener Fachleute unberechtigt in Anspruch genommen, wenn unter Berufung auf diese etwa behauptet wird, allein der Umstand, daß eine Sanierungssatzung festgesetzt wurde, belege bereits, daß ohne Sanierung nichts vorangegangen wäre, weil dies Tatbestandsvoraussetzung für eine (rechtmäßige) Sanierungsfestsetzung sei. Eine „Was-wäre-ohne-Sanierung„-Entwicklung sei daher nicht zu eliminieren. Dies scheint mit Kommentierungen z. B. von Prof. Wolfgang Kleiber übereinzustimmen.
Doch diese Inanspruchnahme von Kleiber ist falsch. Kleiber lehnt die AV Ausgleichsbeträge und das Herumexperimentieren mit einem Ersten, Zweiten (und Dritten) Berliner Modell entschieden ab. Das Verfahren könne noch nicht einmal von Fachleuten nachvollzogen werden. „Die Höhe des Ausgleichsbetrags bemißt sich nach den gesetzlichen Vorgaben aus der Differenz zweier Verkehrswerte und nicht nach theoretischen Modellvorgaben und ex cathedra zahlenmäßig vorgegebenen Parametern einer Verwaltungsbehörde. Modelltheoretisch kann aus einer schulnotenmäßig abgeleiteten Verhältniszahl zum Zustand eines Grundstücks vor und nach Sanierung und ihrer Anwendung auf den sanierungsunbeeinflußten Anfangswert auch gar nicht erwartet werden, daß sie zum Endwert führt, solange dieses Modell nicht maßstabsmäßig an den Endwert justiert wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn in diese Verhältniszahl auch Änderungen eingehen sollen, die nicht sanierungsbedingt sind„, so Kleiber in einer Stellungnahme gegenüber dem Verfasser. Denn natürlich gebe es Änderungen, die auch außerhalb von Sanierungsgebieten das allgemeine Marktgeschehen beeinflussen. Daher berücksichtigten Bodenpreisindexreihen durch eine hochindizierte Anfangsqualität die sich allgemein auch außerhalb von Sanierungsgebieten vollziehenden Verbesserungen.
Nach Auffassung des Verfassers entspricht die Berücksichtigung einer „was wäre ohne Sanierung passiert„-Entwicklung bereits dem Wortlaut des § 154 Abs. 2 BauGB der ausdrücklich einen „was wäre wenn„ –Vergleich vorgibt, wenn es dort eben heißt, Anfangswert sei: „der Bodenwert, der sich ergeben würde, wenn eine Sanierung weder beabsichtigt noch durchgeführt worden wäre„. Die Reduzierung dieser Aussage auf einen „Bodenwert von heute im Anfangszustand„ und die Definition des letzteren als faktisch unverändert wäre nämlich ein Zirkelschluß. § 154 Abs. 2 BauGB definiert gerade auch diesen „Anfangszustand„, er darf nicht innerhalb der Definition als (anderweitig definiert) vorausgesetzt werden. Denn dem „Wert der sich ergeben würde„ ist der Zustand der sich ergeben würde immanent, da Zustand und allgemeine Wertverhältnisse 2 Komponenten sind, die erst zusammen den „Wert„ ergeben. Keinesfalls läßt sich vertreten, der Wortlaut des § 154 Abs. 2 BauGB verbiete eine solche Interpretation. Läßt der Wortlaut eine Interpretation im Sinne des Verfassers zu, so ist Art. 3 I GG zu beachten, der eine Interpretation gebietet, die eine fiktive Entwicklung auch ohne Sanierung berücksichtigt: Denn würden etwa die Sanierungsgebiete in den neuen Ländern und dem Ostteil Berlins insoweit mit klassischen Sanierungsgebieten im Westen gleichbehandelt, also auch für sie unterstellt, daß sich ohne Sanierung nichts gebessert hätte, so würde wesentlich ungleiches rechtswidrig gleich behandelt. Für Westberlin hat in Folge der vereinigungsbedingten Besonderheiten das Gleiche zu gelten, soweit es um Veränderungen nach 1990 geht. Und wo wäre die Eliminierung nicht sanierungsbedingter Elemente technisch besser verortet, als bei der Definition der Ausgangsqualität durch entsprechende Auslegung der Anfangswertdefinition? Allerdings ist die Verortung nicht entscheidend: Will man nicht den Anfangswert modifizieren, so bleibt der Prüfungspunkt „sanierungsbedingt„ gleichwohl bestehen und nicht sanierungsbedingte Entwicklungen sind an anderer Stelle auszuklammern.
Die Behörden mißinterpretieren die Kommentierung in Ernst-Zinkahn-Bielenberg § 153 BauGB Rn. 61 ff. Zwar wird dort für 153 BauGB, der nach seinem Wortlaut anders als § 154 BauGB keinen „Was-Wäre-Wenn-Vergleich vorschreibt, die Berücksichtigung einer „Wäre-wenn-Entwicklung„ vordergründig als angebliche Mindermeinung abgelehnt. Doch darf diese Aussage nicht sinnentleert werden, in dem sie von ihrer Begründung getrennt wird. Diese lautet (§ 153 BauGB Rn. 63): „Sie (die Entschädigungsqualität) muß schon deshalb fixiert bleiben, weil nach den Anwendungsvoraussetzungen des Besonderen Städtebaurechts … nicht mit einer selbständigen qualitativen Weiterentwicklung gerechnet werden konnte (conditio sine qua non)„. Diese Aussage paßt für die neuen Bundesländer offensichtlich nicht, da hier Sanierungsgebiete festgesetzt wurden, wenn ohne Festsetzung z.B. nicht mit der gewünschten „sozialen„ Sanierung gerechnet werden konnte oder wegen der großen Aufgaben eine beschleunigte Entwicklung angestrebt wurde, dagegen nicht nur, wenn überhaupt keine bauliche Sanierung/Standardverbesserung erwartet werden konnte. Nur letztere aber stellt die Berliner Verwaltung im Zielbaum als sanierungsbedingt in Rechnung (weniger Podesttoiletten, Ofenheizungen…). Solche vorwiegend sozialpolitisch motivierten Modernisierungs- und Instandsetzungsgebiete waren bislang nicht nach § 154 BauGB zu beurteilen, da erst jetzt die ersten Abrechnungen hierfür anstehen. Weiter wird in der gesamten Literatur zumindest eben diese „Conditio sine qua non„ gefordert, also mindestens, „daß ohne das Sanierungs- bzw. Entwicklungsunternehmen die STÄDTEBAULICHE Sanierung bzw. Entwicklung in absehbarer Zeit nicht erwartet werden kann.„ „Absehbare Zeit„ muß dabei offensichtlich jedenfalls der Zeitraum sein, den auch die städtebauliche Sanierung in Anspruch nimmt, da ja ihr Nutzen (Beschleunigung…) zu beurteilen ist. Auch diese Prämisse wird in den neuen Ländern und Berlins östlichen Bezirken nicht erfüllt, da zwischen 1990 und 2010 (Mindestlaufzeit der Sanierungsgebiete) sehr wohl eine Entwicklung zu erwarten war – erst recht in der Mitte der deutschen Hauptstadt. Schon allein jeder einzelne Straßenzug neben den Sanierungsgebieten mit ihren oft eher willkürlichen Rändern belegt dies. Kleiber in Ernst-Zinkahn-Bielenberg § 153 BauGB Rn. 61 ff. und die dortigen weiteren Nachweise beurteilen eine städtebauliche Entwicklung in einem Devestitionsgebiet, das trotz Jahrzehnten der Marktwirtschaft nicht vorankommt und nun gründlich umgestaltet wird. Sie meinen nicht Wohnquartiere, die in der DDR systembedingt verkamen und nun lediglich baulich instand gesetzt werden. Der Unterschied wird vollends deutlich, wenn Kleiber unter Bezug auf Janning (Bodenwert und Städtebaurecht, 1976, S. 95 ff.) formuliert: „Solche nicht hinwegdenkbaren Bedingungen„ seien „Bauleitplanung, Bodenordnung, Erschließungs- und Folgeeinrichtungen, also Maßnahmen, die nach § 136 ff. BauGB Grundelemente städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sind„. Denn wo bitte sind diese Grundelemente in Sanierungsgebieten wie dem Kollwitzplatz oder der Spandauer Vorstadt? Wo hat dort Bauleitplanung oder Bodenordnung stattgefunden, welche Erschließungsanlagen wurden (mehr als im Ostteil vereinigungsbedingt üblich) erneuert, geschweige denn neu geschaffen? Es mag sein, daß bei der Festlegung der Sanierungsziele solche klassischen Maßnahmen geplant waren und eine überdurchschnittlich gute Entwicklung angestrebt wurde. Doch diese Maßnahmen und Ziele sind aus Geldmangel zum Großteil schon offiziell gestrichen, der Rest wird der fehlenden Finanzierung auch noch zum Opfer fallen. In den östlichen Bezirken geht es in praxi lediglich um Instandsetzung und Modernisierung, nicht um die Schaffung neuer Strukturen.
Der Kernsatz von Kleiber (Rn. 65) lautet schließlich „Aus den dargelegten Gründen ist es unzulässig, bei der Ermittlung des entwicklungsunbeeinflußten Grundstückswerts werterhöhend zu berücksichtigen, daß auch ohne Einleitung der Entwicklungsmaßnahme – allein auf Grundlage des allgemeinen Städtebaurechts – eine Werterhöhung im Veranstaltungsgebiet eingetreten sein würde„. Eine „allein auf Grundlage des allgemeinen Städtebaurechts„ beruhende allgemeine Entwicklung (im Bereich Bodenordnung, Bauleitplanung, Infrastruktur!) soll also nach dieser Auffassung nicht unterstellt werden dürfen. Die Wiedervereinigung mit ihren Systemumwälzungen und die erstmalige Geltung des grundgesetzlichen Gebots einheitlicher Lebensverhältnisse auch im Ostteil Berlins können aber wohl kaum als „allgemeines Städtebaurecht„ bezeichnet werden. Wer also – wie der Verfasser – fordert, eine „Was-wäre-wenn-Entwicklung„ in den neuen Ländern und dem Ostteil Berlins zu berücksichtigen, behauptet alles andere als „nur auf Grundlage des allgemeinen Städtebaurechts„ eingetretene Entwicklungen. Die offensichtlich allein vor dem Hintergrund westdeutscher Sanierungsgebiete, in denen der Markt „am Ende„ war und die nur mit staatlichen Mitteln großflächig neu geordnet wurden, getroffenen Aussagen werden mißbraucht, will man Sie für eine Außerachtlassung der allgemeinen Fortentwicklung im Beitrittsgebiet in Folge der Wiedervereinigung heranziehen. Diese Aussagen sind bezogen auf vom freien Markt vernachlässigte Gebiete, in denen Fußgängerzonen und Parks entstanden, auf Industriebrachen, die zu Wohnquartieren wurden. Nicht bezogen sind sie auf das Neutünchen Sozialismus-verfallener Fassaden am Kollwitzplatz oder das Verschwinden von Ofenheizungen in der Hauptstadt eines der reichsten Länder der Welt bis 2010. Daher gibt es (soweit dem Verfasser bekannt) nicht einen einzigen Fachbeitrag der fordert, die wiedervereinigungsbedingten Veränderungen zwischen 1990 und 2020 als „sanierungsbedingt„ anzusehen.
Grundsätzlich scheinen i. ü. generelle Zweifel an o. g. Argumentation angebracht, da es sich um einen staatsgläubigen Zirkelschluß handelt, der letztlich lautet: „Was nicht sein darf (Sanierungssatzung trotz milderer/anderer Mittel zur Zielerreichung) kann nicht sein„. Solche Zirkelschlüsse aber sind keine objektiv tragfähige Argumentation. Dies gilt zumal dann, wenn man betrachtet, wie viele rechtswidrige Festsetzungen bzgl. Sanierungsgebiete die Berliner Verwaltung in den letzten Jahren zu Stande gebracht hat. Allein der Umstand also, daß sich niemand gegen die Sanierungssatzung gewehrt hat, heißt noch lange nicht, daß diese rechtmäßig festgesetzt worden ist.
6.2.4 Belege für eine Entwicklung auch ohne Sanierungsgebiete
Für die These, daß es insbesondere in vielen Ostberliner Sanierungsgebieten auch ohne Sanierungssatzung zu großen Investitionen gekommen wäre, während die „Sanierungsziele„ die Investoren ausbremsen sollten und öffentliche Mittel allein auf die „soziale Erneuerung„ konzentriert wurden, gibt es eine Vielzahl entsprechender Belege. Als Argumentationshilfe seien einige hier genant:
Andrey Holm, Mieterecho 1998:
„Denn in Ostberlin hat sich ein tief greifender Wandel der Sanierungspolitik vollzogen - sie ist zunehmend unsozial, da Stadterneuerung in Ostberlin trotz der riesigen Investitionsunterlassungen nicht in einem 'klassischen Desinvestitionsgebiet' durchgeführt wird, sondern unter einem teilweise enormen Verwertungs- und Nachfragedruck stattfindet. Viele Altbauviertel in Ostberlin (Spandauer Vorstadt, Kollwitzplatz) sind auch bei besserverdienenden Haushalten eine attraktive Wohnadresse geworden. Soziale Zielsetzungen der Erneuerung können nicht mehr durch Investitionsstimuli für „dezidiert nichtkapitalistische" Akteure der Stadtentwicklung (Welsch-Guerra 1992: 37) durchgesetzt werden, sondern nur als Gegensteuerung zu renditeorientierten Investitionen.„
Sanierungszeitschrift „Vor Ort„ Mai 2000 – Mieterberatung Prenzlauer Berg:
„Wie könnten ohne Mietobergrenzen die vom Senat beschlossenen Sanierungsziele "Schutz der Wohnbevölkerung vor Verdrängung" und "Vermeidung sozialer Segregation" umgesetzt werden? Und wie könnte ein großflächiger Austausch von Bewohnern durch überteuerte Modernisierungen in den bevorzugten Lagen von Prenzlauer Berg, oder Mitte verhindert werden? Während derzeit die spekulativ erhöhten Grundstückspreise deutlich zurückgehen und damit eine maßvolle Modernisierung wieder ermöglicht wird, müßten bei einem Wegfall von Mietobergrenzen Grundstückspreise gezahlt werden, die sozial verträgliche Mieten nach Modernisierung gar nicht mehr zulassen.„
Das Verwaltungsgericht Berlin:
„Mietobergrenzen haben die Zahl privater Sanierungen drastisch reduziert„ (GE 5/2001).
Die Statistik des Senats:
Von 1993-2000 wurden 65,3 % aller aufgewendeten Mittel im Programm „Soziale Stadterneuerung„ aufgewendet.
http://www2.rz.hu-berlin.de/stadtsoz/Forschung/Daten%20Prenzlauer%20Berg.pdf
Der in Pankow verantwortliche Stadtrat (Mietermagazin März 2002):
„Vor allem in attraktiven Lagen wie der Spandauer Vorstadt in Mitte oder am Kollwitzplatz in Prenzlauer Berg wurde die bauliche Sanierung zum Selbstläufer. Der Druck auf die Mieter wurde deshalb stärker. Um sie vor Verdrängung zu schützen, wurden Mietobergrenzen, Belegungsbindungen und Sozialplanverfahren eingeführt. Zahlen aus Prenzlauer Berg besagen, daß bei öffentlich geförderten Sanierungsmaßnahmen 70 Prozent der Bewohner in den Häusern verbleiben, bei freifinanzierten nur 50 Prozent. "Die öffentliche Förderung der sozialen Stadterneuerung ist unerläßlich, um auch die sozialen Sanierungsziele durchzusetzen", folgerte Andreas Bossmann (für PDS), bisheriger Pankower Stadtrat für Stadtentwicklung und Soziales.„
Der Senat:
„Wegen seiner citynahen Lage und der bekannten Kulturszene besitzt das Gebiet für Investoren und Touristen eine hohe Attraktivität„ (http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/stadterneuerung/de/kollwitz/index.shtml)
Die Mieterzeitschrift Scheinschlag:
„Die erneuerungsbedürftige Bausubstanz war weitaus umfangreicher, gleichzeitig stand weniger Geld für die Stadterneuerung zur Verfügung. Statt nur mit öffentlichen Geldern zu sanieren, konnte der Senat lediglich versuchen, mit Fördergeldern die Investitionen der privaten Hauseigentümer anzukurbeln. Doch das wäre gar nicht überall nötig gewesen, denn anders als im Kreuzberg der 80er Jahre, wo sich Investitionen in alte Wohnhäuser für den Eigentümer kaum lohnten, herrscht im Osten im Hauptstadt- und Metropolenrausch ein hoher Investitionsdruck, der vor allem auf der Spandauer Vorstadt und dem Kollwitzplatz lastet.„ (http://www.scheinschlagonline.de/archiv/1998/24_1998/texte/news01.html)
Eine vom Senat in Auftrag gegebene Studie der Humboldt Universität:
„Das Verkaufsverhalten der Alteigentümer war in Prenzlauer Berg aber kein Hindernis bei der Gewinnung von Investoren für die Altbausanierung. Das Fördergebietsgesetz und die aus Lage und Image herrührende Attraktivität des Gebietes riefen eine vergleichsweise große Nachfrage privater und professioneller Akteure auf den Plan„ Lediglich die Rechtsunsicherheit durch die Restitutionsverfahren hat bis 1993 zu einer Blockade geführt, die starke Steigerung bis 1996 spiegelt einzig und allein die Lösung dieses Problems wieder Häußermann/Glock/Keller http://www2.rz.hu-berlin.de/stadtsoz/Forschung/wp_02.pdf S. 13ff.
Eine Studie der DFG mit Untersuchungsobjekt Prenzlauer Berg:
„Der Wandel in Prenzlauer Berg war a. auf Grund der Transformation der Eigentumsstruktur, b. wegen der allgemein akzeptierten Notwendigkeit von Investitionen und c. durch die kulturelle Neubewertung des Bezirks nach der Wende unausweichlich„. http://www2.rz.hu-berlin.de/stadtsoz/Forschung/ErgebnissePB.PDF
Hingewiesen sei auch auf die „Topos-Studien„ von 1991(Prenzlauer Berg) 1993 (Prenzlauer Berg), 1994 (Östliche Sanierungsgebiete) und vor allem 1996 (Prenzlauer Berg „Milieu„), die eine starke Wirtschaftsdynamik belegen, die „gebremst„ werden muß, um eine „gentrification„ (Austausch der Bewohnerstruktur) zu verhindern.
6.3. Zu den einzelnen Feldern des Bewertungsrahmens gem. AV-Ausgleichsbeträge 2002:
In Stichpunkten seien einzelne Felder und Fehleinordnungen genannt, die dem Verfasser als besonders kritisch bekannt wurden. Die Punkte sind alles andere als abschließend und können nur als Ideenfundus dienen:
Lagekriterium 1 – Stadtbild – 1.1. Erscheinungsbild: Hier wird häufig bereits bei einem Sanierungsdurchgriff von 50 % ein „durchschnittliches Erscheinungsbild„, bzw. bei 70 % eine „gute Situation„ behauptet. Maßstab ist angesichts des einheitlich geltenden Zielbaums aber das Zentrum Berlins – Ost wie West. Maßstab ist angesichts der Methodologie des Zielbaums zudem die Innenstadt insgesamt, nicht nur Sanierungsgebiete. Und daß 50 % verfallene Fassaden eines DDR-Altbauviertels als „durchschnittlich„ auch für Wilmersdorf oder Charlottenburg gelten sollen, kann nicht vertreten werden.
1.2. Nutzungskonflikte: Häufig wird nicht eine einzige gewerbliche oder sonst störende Nutzung sanierungsbedingt beseitigt. Industrieanlagen im Ostteil fielen regelmäßig der Marktwirtschaft und nicht dem Sanierungsamt zum Opfer.
Lagekriterium 2 – Bebauungsdichte: Gerade in den östlichen Bezirken erfolgt kaum ein Abriß. Selbst marodeste Seitenflügel wurden bzw. werden mit staatlichen Mitteln erhalten, um billigen Wohnraum anbieten zu können. Dann kommt aber eher eine Verschlechterung durch die Maßnahmen der Sanierungsverwaltung als eine Verbesserung in Betracht. Nur wenn konkrete, sanierungsbedingte Abrisse benannt werden können, die sich auf das Grundstück auswirken, kommt eine positive Notendifferenz in Betracht. Sanierungsbedingte Neubauten (Sozialer Wohnungsbau…) sind andererseits als Verdichtung zu berücksichtigen. Bleibt man im System der Verwaltung (100 % der Geschehnisse sanierungsbedingt) sind auch alle sonstigen Lückenschlüsse und Dachgeschoßausbauten etc. anzusetzen, was zu einer negativen Entwicklung führt.
Lagekriterium 3 – Erneuerungsbedarf: Hier gilt das zu 1.1 gesagte.
Lagekriterium 4 – Ausstattung der Wohnungen: Hier ist besonders zu fragen, ob tatsächlich das Verschwinden von Ofenheizungen und Außentoiletten allein durch städtebauliche Maßnahmen bedingt ist. Denn die Behörde behauptet damit, daß ohne ihr Wirken auch 2010 oder später mitten in Berlin noch 70 % der Wohnungen kein Bad und Ofenheizung hätten. Zudem wird häufig die Note 5 („hoher Anteil an OH/PT oder AWC„) vergeben und dabei übersehen, daß dafür ein hoher Anteil (d.h. mehr als 50 %) der Wohnungen Ofenheizungen UND zugleich Podesttoilette oder Außenklo haben mußte. Denn eine mehrheitliche Ausstattung mit Ofenheizung aber Innentoilette (und ohne Bad) wird durch Note/Feld 4 erfaßt.
Lagekriterium 5 – Bodenordnende Maßnahmen: Häufig findet gar keine Bodenordnung durch die Sanierungsverwaltung statt. Zwangsmittel werden nicht eingesetzt, Geld für Ankäufe oder Enteignungen ist auch gar nicht vorhanden. Zudem ist der Bedarf an einer Neuordnung angesichts bereits vor 100 Jahren gut geordneter Wohngebiete in den zentralen Bezirken kaum vorhanden.
Lagekriterium 6 – Aufenthalts- und Gestaltungsqualität des Straßenraums: Der Zustand der Straßen in den östlichen Bezirken, das Fehlen von Straßenbegleitgrün und z.B. der Kampf des Pankower Bezirksamts gegen Fassadenbegrünungen lassen sanierungsbedingte Verbesserungen zu einer „guten„ Situation, wie sie meist behauptet wird, nicht gerechtfertigt erscheinen. Wo Straßenzustände verbessert wurden, ist besonders zu prüfen, mit welchen Mitteln und in welchem Rahmen. In den seltensten Fällen dürften die Maßnahmen solche im Zusammenhang mit der Sanierungssatzung sein.
Lagekriterium 7 – Öffentliche Grün- und Freiflächen: Der Anfangszustand wird häufig in %-Versorgungsgrad und entsprechend schlecht bewertet. Dann werden pauschal Verbesserungen behauptet, ohne einen Versorgungsgrad im Endzustand anzugeben und diesen dann einzuwerten. Marginale oder auch gar keine neuen Grünflächen sollen so Verbesserungen rechtfertigen, während der (in zentralen Lagen stets zu geringe) %-Versorgungsgrad eine möglichst schlechte Ausgangsnote sichert. Hier ist eine einheitliche Methodik zu fordern, die den Endwert beim Anfangswert ansiedeln dürfte. Denn die großen und damit Versorgungsgradprägenden Parks haben sich nicht verändert.
Lagekriterium 8 – Private Freiflächen: Irgendein Einfluß der Sanierungsverwaltung neben den allgemeinen Auflagen der Berliner Bauordnung bzgl. Hofentsiegelung und privater Spielplätze ist nicht erkennbar.
Lagekriterium 9 – Luft- und Lärmbelastung: Der PKW-Verkehr dürfte häufig deutlich zugenommen haben. Einzig reduziert dürften die Abgase aus Heizungsbrand sein. Wieder stellt sich die Frage, ob das Verschwinden der Ofenheizungen sanierungsbedingt ist. Hinzu kommt, daß die Luft in den meisten Sanierungsgebieten gegenwärtig schlechter ist, als durch die in Kürze (01.01.2005) greifenden europarechtlichen Vorgaben vorgeschrieben. Wenn aber ein (europarechtlicher) Anspruch auf eine bestimmte Luftqualität besteht, so ist dies eine allgemeine und keine sanierungsbedingte Entwicklung. Der „Luftreinhalteplan„, den der Senat etwa im November vorlegen will, gilt für ganz Berlin. Damit scheidet eine Qualifikation als „sanierungsbedingt„ aus, da auch ohne Sanierungsgebiet das zwingende Europarecht einzuhalten wäre.
Lagekriterium 10 – öffentliche Infrastruktur: (Schulen, Kindergärten etc.): Anders als beim Kriterium 7 werden hier häufig keine konkreten Maßnahmen genannt, sondern hier soll nun der künftig bessere %-Versorgungsgrad maßgeblich sein. Die einfache Erklärung: Es wurden Schulen und Kindergärten geschlossen, da aber in noch größerem Umfang die Zahl der Kinder zurückgeht, verbessert sich die %-Versorgungsrate. Der Geburtenrückgang soll also eine Segnung des besonderen Städtebaus sein. Abgesehen davon, daß Geburtenrückgang bzw. Familienwegzug Belege für das Scheitern der Sanierungsämter sind, hieße eine Wertung als sanierungsbedingt, daß sich das Sanierungsamt den Familienwegzug als zu bezahlenden Erfolg auf die Fahnen schreibt.
Lagekriterium 11 – Verkehrssituation: Wer wie die Behörde unkorrigiert zwei historische Zustände vergleicht, wird hier häufig zu einer wesentlichen Verschlechterung bei der Stellplatzsituation kommen müssen. Der (mit der Behördenauffassung „sanierungsbedingt„) erhöhte Verkehr führt erstmals zu einer Reihe von Nutzungskonflikten (zugeparkte Straßen als Gefahr für Fußgänger etc.), die durch ein paar neue Ampeln nicht aufgewogen werden.
Lagekriterium 12 – Einzelhandel, Dienstleistungen und Kultur: Hier ist wieder die Frage „sanierungsbedingt„ in Ostberlin besonders offensichtlich. Nach 1990 neu entstandene Supermärkte sind regelmäßig vom Sanierungsamt lediglich „nicht erfolgreich verhindert„, nicht dagegen gefördert worden. Aldi & Co. sind aus wirtschaftlichen Gründen in ganz Deutschland, nicht wegen der freundlichen Mitarbeiter in der Sanierungsverwaltung. Bei den kulturellen Einrichtungen ist zu fragen, ob hier tatsächlich nur auf das Sanierungsgebiet abzustellen ist, selbst wenn das betreffende Grundstück z.B. näher an „Unter den Linden„ liegt, als an der Kulturbrauerei. Auch fragt sich, welchen nennenswerten finanziellen Zusatzwert eine bezirkliche Kultureinrichtung für ein Grundstück haben kann, das etwa in Gehweite der „Hauptstadtkultur„ liegt. Nach der Lehre vom „Grenznutzen„ dürfte sich hier tatsächlich kein nennenswerter Werteffekt mehr ergeben.
6.4. Die tatsächlichen Auswirkungen der „sozialen Sanierung„
Es sei nochmals klargestellt, daß das Setzen von sozialen Zielen beim Stadtumbau Ost ein richtiger, notwendiger Schritt war. Daher geht es auch nicht darum, das Bemühen von Senat und Bezirken zu kritisieren, die bestehenden Bewohnerstrukturen im Zentrum Berlins vor Verdrängung zu schützen und lieber billigen Wohnraum als „Schicki-Micki„ Viertel zu befördern. Doch bei der im Rahmen des Sanierungsausgleichsbetrages allein gebotenen finanziellen Betrachtung ist festzustellen, daß es gerade in den zentral gelegenen Sanierungsgebieten wie der Spandauer Vorstadt oder dem Kollwitzplatz ohne Sanierungssatzung zu einer für die Grundstückseigentümer attraktiveren Situation gekommen wäre. Es kann nicht richtig sein, zu behaupten, man habe hunderte Millionen in die „soziale Stadterneuerung„ investieren müssen, um vor Verdrängung und überteuerten Sanierungen zu schützen, und gleichzeitig zu behaupten, ohne Sanierungssatzung hätten keine Modernisierungen durch Private stattgefunden. Die „Topos-Studien„ von 1991(Prenzlauer Berg) 1993 (Prenzlauer Berg), 1994 (Östliche Sanierungsgebiete) und vor allem 1996 (Prenzlauer Berg „Milieu„) belegen, daß es z.B. im Bereich Kollwitzplatz zu massiven Investitionen (und einer Verdrängung von finanziell schwächeren Schichten) gekommen wäre. Milieuschutzsatzungen in angrenzenden Gebieten wurden gerade mit dieser Erkenntnis begründet, soziale Sanierungsziele gerade hiermit befördert. Mit diesen Ergebnissen setzen sich die Ausgleichsbetragsermittlungen der Verwaltung nicht auseinander.
7. Ansatz von Ertragsminderungen durch Mietbindungen und –obergrenzen
In den Sanierungsgebieten bzw. den Bescheiden zur Sanierungsgenehmigung sind vielfach Mietobergrenzen festgesetzt. Die Gestaltungen hierzu sind angesichts der rechtlichen Fragwürdigkeiten einerseits und dem unbedingten Willen der Bezirksämter andererseits mannigfaltig. Jedenfalls kommt es häufig zu einer faktischen Begrenzung der zulässigen Erträge. Dies ist m. E. eine klar „sanierungsbedingte„ Einschränkung, die auf den Bodenwert durchschlägt. Es erscheint vertretbar, eine sanierungsbedingte Wertminderung wie folgt zu berechnen:
Marktüblicher Mietertrag – Sanierungsbedingte „Bindungsmiete„ = Minderertrag
Die Summe der Mindererträge – die in künftigen Jahren dabei abgezinst – ergibt die sanierungsbedingte Wertminderung für das Grundstück.
Die Minderung für künftige Jahre ergibt sich entweder aus vertraglich/durch Bescheid festgelegten fortgeschriebenen Bindungsmieten oder durch eine Fortschreibung der gebundenen Ausgangsmieten mit dem allgemeinen Mietrecht (20 % Erhöhung alle 3 Jahre) und läuft somit zu einem benennbaren Zeitpunkt aus.
In der allgemeinen Wertermittlungspraxis (z.B. bei gerichtlichen Verkehrswertgutachten in Zwangsversteigerungsverfahren für preisgebundene Objekte, bei denen es für eine gewisse Zeit zu Fortwirkungen einer Mietpreisbindung kommt) ist dies ein übliches Verfahren und es erscheint lohnend, diesen Ansatz zu verfolgen, da die einnahmenbeschränkende Praxis der Mietobergrenzen nicht ohne Relevanz für die Frage sein kann, welchen abzuschöpfenden „Vorteil„ der Eigentümer aus einer Sanierungsmaßnahme hat.
8. „rb„ – der „rentierliche Bodenwertfaktor„ im Berliner Modell
Davon zu unterscheiden ist i. ü. das allgemeine Verfahren, nachdem die Berliner Verwaltung gewissermaßen einen prozentualen Nachlaß auf den Ausgleichsbetrag gibt, wenn die aufstehende Bebauung den rentierlichen Anteil der Bodenwerterhöhung mindert. Der Ausgleichsbetrag wird dazu mit dem „rentierlichen Bodenwertanteil„ („rb„) multipliziert, soweit dieser kleiner 1 ist, was zu einer entsprechenden Reduktion führt. Diese Praxis ist seitens der Verwaltungsgerichte in Zweifel gezogen worden, da sich im Gesetz keine Stütze für die Berücksichtigung der aufstehenden Bebauung für die Ermittlung des Ausgleichsbetrags finde. Nach diesseitiger Ansicht bedarf es einer solchen Stütze aber nicht um „rb„ weiter anzuwenden. Denn es muß sich nicht um einen (im Gesetz nicht vorgesehenen) Rechenschritt zur Ermittlung der Bodenwerterhöhung handeln, sondern man kann „rb„ auch als standardisiertes (Teil)erlaßverfahren ansehen: § 155 Abs. 3 und 4 BauGB geben der Behörde das Recht, von einer Erhebung des Ausgleichsbetrags im öffentlichen Interesse (teilweise) abzusehen. Ein solches öffentliches Interesse kann auch das Anliegen sein, Eigentümer bebauter und meist zu Mietshauszwecken genutzter Grundstücke nicht weiter zu überfordern, um ein weiteres Anwachsen von Zwangsversteigerungen und Mietsteigerungen zu verhindern. Diese politische Verzichtsentscheidung ist auch dann zu akzeptieren, wenn sie verfahrenstechnisch mit der Wertermittlung verknüpft erscheint, da es der Verwaltung offen steht, den Trennschnitt zwischen Betragsermittlung und Betragsfestsetzung zu definieren.
9. Fazit
Eine „sanierungsbedingte„ finanziell positive Entwicklung in den Sanierungsgebieten ist vielfach nicht auszumachen. Bedingt durch „soziale Sanierungsziele„ bleiben die Gebiete hinter ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten zurück. Die Bewertung „sanierungsbedingt„ der Verwaltung unterliegt jedenfalls in vollem Umfang gerichtlicher Kontrolle und es ist daher zu hoffen, daß das Berliner Verwaltungsgericht der Behauptung, im Ostteil Berlins gebe es keine „allgemeine positive Entwicklung von 1990 – 2010„ ein Ende setzt. Mit Krautzberger (Battis/Krautzberger BauGB 6. A. § 142 Rn. 36) sei klargestellt: „Ist nicht die Umstrukturierung eines Gebietes beabsichtigt, sondern in erster Linie die Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung vorhandener baulicher Anlagen, sind erfahrungsgemäß Bodenwertsteigerungen nicht zu erwarten…„.
III. Problematische Tendenz der Verwaltungsgerichte zur Neufestsetzung durch Gutachten
Dem Betroffenen, der sich angesichts oben dargestellter Fragwürdigkeiten hilfesuchend an die Verwaltungsgerichtsbarkeit wendet, droht weiteres Ungemach: Wegen der Komplexität der Wertermittlungsfragen tendieren die Gerichte dazu, sich völlig von einer rechtlichen Beurteilung der konkret durch die Anfechtungsklage angegriffenen Bescheide zu lösen und statt dessen ein Gutachten zur Ermittlung des korrekten Ausgleichsbetrags in Auftrag zu geben. Statt wie in § 113 Abs. 1 VwGO als Regelfall vorgesehen, schlicht die Rechtswidrigkeit des angegriffenen Bescheids über den Ausgleichsbetrag festzustellen und diesen aufzuheben, wird er (mit anderer Begründung, nämlich mit dem eingeholten Gutachten) (teilweise) aufrecht erhalten. Ist nun der festgesetzte Ausgleichsbetrag relativ gering und – wenn auch deutlich übersetzt – so doch vielleicht zu einem kleineren Teil berechtigt, droht dem betroffenen Kläger, einen Teil der (hohen) Kosten eines solchen Gutachtens tragen zu müssen. Er steht vor der Alternative, entweder die offenkundig rechtswidrige Berechnung der Verwaltung zu akzeptieren, oder sie (teilweise) auf seine Kosten durch die Berechnung eines gerichtlich bestellten Gutachters ersetzen zu lassen.
Ein solches Vorgehen ist nach diesseitiger Auffassung rechtsfehlerhaft: Zwar normiert § 113 Abs. 2 S. 1 VwGO die Möglichkeit einer Neufestsetzung durch das Gericht bei auf Geldleistung gerichteten Bescheiden. Doch kann das Gericht im Ergebnis nicht einen VA schaffen, dessen tragende Begründung die Behörde selbst im Prozeß nicht hätte nachholen können (Kopp/Schenke § 113 VwGo Rn. 153 unter Verweis auf Müller, NJW 1978, 1357; vgl. auch BVerwG 69, 92). Bei einem Sanierungsausgleichsbetrag fehlt auch jeder Aspekt einer Eilbedürftigkeit, der in BVerwG 69, 91 zu einem anderen Ergebnis führte. Anders als in den bisher zu Gunsten einer Abänderungsbefugnis mit neuer Berechnung (statt reiner Kassationsbefugnis) entschiedenen Fällen handelt es sich auch nicht um eine eigene – durch die Gerichtsgebühren abgedeckte – Rechenarbeit des Gerichts, sondern um eine teure externe Gutachterleistung, die wirtschaftlich gesehen (Teilkostenlast aus den hohen Gutachterkosten) den Rechtsschutz des Betroffenen einschränkt.
Vor allem aber liegt mit Begriffen des allgemeinen Verwaltungsrechts gesprochen letztlich ein Problem des sogenannten „Nachschiebens von Gründen„ im Verwaltungsprozeß vor. Der erlassene Verwaltungsakt (Ausgleichsbetrag) soll nach Klageerhebung des Beschwerten auf eine ganz andere Begründung gestützt werden. Nach der wohl herrschenden Meinung (vgl. Kopp/Schenke § 113 VwGO Rn. 63 ff.) ist dieses Nachschieben zwar grundsätzlich zulässig. Bei Ausgleichsbetrags-Bescheiden aber handelt es sich jedenfalls um Verwaltungsakte mit Beurteilungsspielraum. Denn zumindest hinsichtlich der Wertung/Gewichtung der einzelnen Kriterien (In Berlin im „Zielbaum„ manifestiert) besteht (s. o.) ein Beurteilungsspielraum der Behörde. Damit sind sie Ermessensverwaltungsakten bereits gleichzusetzen. Zudem liegt auch ein eigentlicher Ermessensspielraum vor: Die oben angesprochenen allgemein gewährten „Nachlässe„ auf den Ausgleichsbetrag, wie die Berücksichtigung nur des „rentierlichen Anteils„ („rb„) bei aufstehenden Bebauung, sind praktischer Ausfluß dieses Ermessensanteils. Die Vorschriften des § 155 Abs. 3 und IV BauGB geben der entscheidenden Behörde ja auch das Recht, von der Erhebung des Ausgleichsbetrags abzusehen oder einen Teilerlaß zu gewähren. § 155 Abs. 3 erlaubt eine entsprechende Entscheidung für das ganze Sanierungsgebiet oder Teile davon, § 155 IV normiert ein Ermessen im Einzelfall. Jedenfalls letzteres kann aber erst dann vollständig und fehlerfrei ausgeübt werden, wenn die Höhe des in Rede stehenden Betrages korrekt ermittelt ist bzw. feststeht. Denn erst wenn man die Höhe des Anspruchs kennt, über dessen Einhebung man ermessensfehlerfrei zu entscheiden hat, kennt man die richtige Entscheidungsgrundlage.
Bei VA mit Ermessens- oder Beurteilungsspielraum kommt eine Abänderung gem. § 113 Abs. 2 S. 1 VwGO aber nicht in Betracht (BVerwG 32, 50; 33, 353; 38, 310; 44, 22; 69, 91; DÖV 1970, 646 u.a.; Kopp/Schenke § 113 VwGO Rn 152 m.w.N.).
Eine Entscheidung durch das Gericht, die bei völlig fehlerhafter Berechnung über eine Aufhebung des fehlerhaften Bescheids oder eine Teilrückverweisung nach § 113 Abs. 2 S. 2 VwGO hinausgeht, nimmt dem jeweiligen Kläger die Ermessensinstanz. Dem Gericht ist ein Nachschieben von Gründen in Form eines komplett neuen/anderen Gutachtens nach Auffassung des Verfassers auch deshalb untersagt, weil es dadurch seinen Beurteilungsspielraum bzw. den Beurteilungsspielraum des gerichtlich bestellten Gutachters unter Verstoß gegen das Gewaltenteilungsprinzip und § 114 VwGO an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzte und einen neuen VA erließe. Dies führte zugleich zu einem Verstoß gegen den Gleichheitssatz. Denn da wie oben gezeigt z.B. die Berücksichtigung von „rb„ jedenfalls als teilweises Absehen von der Erhebung im öffentlichen Interesse zulässig ist, verlangt der betreffende Kläger, wenn er (anders als vielleicht ein Gutachter) dies zu berücksichtigen fordert, keine „Gleichbehandlung im Unrecht„, sondern eine ganz normale rechtliche und tatsächliche Gleichbehandlung. Wird statt dessen durch ein gerichtlich bestelltes Gutachten ohne „rb„ festgesetzt, so liegt eine gleichheitswidrige Behandlung vor.
Eine Neufestsetzung nach Gerichtsgutachten übersieht zudem, daß es grundlegende Pflicht der Verwaltung ist, auf ihre Kosten eine korrekte Ermittlung zu erstellen oder erstellen zu lassen. Diese Pflicht darf nicht – auch nicht teilweise – wirtschaftlich beim Betroffenen abgeladen werden. Daher kommt nach Auffassung des Verfassers in all jenen Fällen, in denen der angegriffene Ausgleichsbetrags-Bescheid nicht nur an geringfügigen Mängeln oder Fehleinschätzungen leidet, sondern so fundamental rechtswidrig ist wie oben beschrieben, nur eine Aufhebung bzw. eine „Teilrückverweisung„ nach § 113 Abs. 2 S. 2 VwGO in Betracht. Nur wenn es um einzelne, wenige Fehler (etwa eine falsche Einordnung einzelner Zustände im Bewertungsrahmen zum Zielbaumschema) ginge, die innerhalb des von der Behörde im Bescheid vorgegebenen Systems und Bewertungsschemas korrigiert werden könnten, kämme eine entsprechende Ermittlung durch das Gericht und eine Modifikation des Ausgleichsbetrags auf eine geringere Summe in Betracht.
In jeder Ausgabe des GRUNDEIGENTUM finden Sie interessante mietrechtliche Gerichtsentscheidungen, Aufsätze, Hintergrundinformationen, Gesetze und Verordnungen sowie wertvolle Praxistips rund um die Grundstücks-, Haus- und Wohnungswirtschaft.
Informieren Sie sich schon vorab im Inhaltsverzeichnis des aktuellen GRUNDEIGENTUM-Heftes, das wir Ihnen im DOWNLOAD-Bereich als PDF-Datei zur Verfügung stellen, über die jeweiligen Inhalte bzw. Themenschwerpunkte!
Dieser Beitrag konzentriert sich vor diesem Hintergrund auf einzelne Fragestellungen, so daß ergänzend die grundsätzlichen Ausführungen z.B. bei von Seldeneck/Dyroff, GE 2/99 S. 89 ff. herangezogen werden können. Die Schwerpunktproblematik des Beitrags, der Begriff „sanierungsbedingt„ als Abgrenzungskriterium zwischen ausgleichspflichtigen Werterhöhungen und der allgemeinen Wertentwicklung ist allgemein, in den neuen Bundesländern und dem Ostteil Berlins aber ist sie besonders dringlich.
I. Aktuelle Entstehung des Ausgleichsbetrags in den östlichen Bezirken Berlins – Warum ein vorzeitiger Abschluß sinnvoll sein kann
Gem. § 154 Abs. 3 BauGB ist der Ausgleichsbetrag nach Abschluß der Sanierung zu entrichten. Zwar ist offenkundig noch kein Sanierungsgebiet in den östlichen Bezirken aufgehoben worden, so daß ein Abschluß nach § 162 BauGB (Aufhebung des gesamten Gebietes durch Satzung) nicht in Betracht kommt. Auf Antrag des Eigentümers hat die Sanierung aber gem. § 163 Abs. 1 BauGB für dessen Grundstück als abgeschlossen erklärt zu werden, wenn entsprechend den Zielen und Zwecken das Grundstück bebaut ist oder in sonstiger Weise genutzt ist oder das Gebäude modernisiert oder instand gesetzt ist. Im Standardfall eines sanierten Altbaus besteht also nach Abschluß der baulichen Maßnahmen regelmäßig ein Rechtsanspruch auf eine vorzeitige Entlassung. Mit der Abschlußerklärung entfällt die Anwendung der §§ 144, 145 und 153 BauGB, also die umfassende Genehmigungsbedürftigkeit zahlreicher Vorgänge (§ 144 BauGB) und die Kaufpreisprüfung gem. § 153 Abs. 1 und 2 BauGB, die Eigentümer im Sanierungsgebiet sonst behindern. Dazu zählen insbesondere die Genehmigungspflicht für Mietverträge auf bestimmte Zeit von mehr als einem Jahr (§ 144 Abs. 1 Nr. 2) und „erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs- zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind„ (§ 144 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 14 Abs. 1 BauGB). Die allen Betroffenen hinlänglich bekannten Behinderungen und Verzögerungen, die eine notwendige Sanierungsgenehmigung (ggf. neben der allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Prüfung) mit sich bringt, können so beseitigt werden. Für künftige Verkaufsfälle besteht eine bessere Verkäuferposition und störende Verzögerungen durch die Kaufpreisprüfung werden vermieden. Bei korrektem Vorgehen der Verwaltung wird die verfrühte Zahlung durch Abzinsung des auf noch nicht erreichte Fortschritte entfallenden Teils des Ausgleichsbetrags sowie durch so genannte Pionier- und Wagnisabschläge reduziert.
II. Ermittlung des Ausgleichsbetrages bei der vorzeitigen Entlassung
1. Grundsätzliches zum „Berliner Modell„
Klargestellt sei vorab, daß Rechtsgrundlage für die Berechnung auch des vorzeitig festgesetzten Ausgleichsbetrags die §§ 152-155 BauGB sind. Für die Gerichte verbindliche gesetzliche Vorgaben ergeben sich hieraus, nicht dagegen aus verwaltungsinternen Regeln. Daher ist die Rechtmäßigkeit der gegenwärtigen Verwaltungspraxis am Gesetz und nicht am Maßstab der AV-Ausgleichsbeträge vom 12.11.2002 (ABl. 2003, S. 1761), als der einschlägigen Handlungsanweisung der Berliner Senatsverwaltung zu prüfen. Jedoch kann sich der einzelne Betroffene auf ihn begünstigende Regelungen der AV-Ausgleichsbeträge insoweit berufen, als diese eine „Selbstbindung der Verwaltung„ herbeiführen. Denn es wäre mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbart, wenn die Masse der Verfahren nach der AV abgewickelt würde, dort wo es der Verwaltung günstig erscheint, aber abgewichen wird.
Maßgeblicher Schritt der Ausgleichsbetragsermittlung ist die Ermittlung der „sanierungsbedingten Bodenwertsteigerung„, also der Differenz zwischen Anfangs- und Endwert. Wie von von Seldeneck/Dyroff in GE 1999, S. 92 ff. dargestellt, bedienen sich die Berliner Behörden dabei einer bestimmten Form der „Komponentenlösung„, nämlich dem „Zielbaumverfahren„. Hieran hat sich durch die neuen AV-Ausgleichsbeträge grundsätzlich nichts geändert. Die Bezirksämter stufen dabei mittels eines Klassifikationsrahmens den Zustand eines Grundstücks vor und nach der Sanierung für verschiedene als wertmaßgeblich ermittelte Komponenten (etwa Bebauungsdichte, Ausstattung der Wohnungen, Stadtbild) ein. Die Zustände werden dazu jeweils mit Noten von 1-5 bewertet. War z.B. zu Beginn der Sanierung eine „erhebliche Beeinträchtigung der Wohn und ggf. Arbeitsverhältnisse„ durch die Bebauungsdichte gegeben, bedeutet dies beim „Lagekriterium 2 - Bebauungsdichte„ Note 4. Ist die Beeinträchtigung am Ende nur mehr „mittelschwer„, führt dies zur Note 3. Die Noten bei den einzelnen Lagekriterien werden dann mit Hilfe des Zielbaums zu einer Gesamtnote zusammengefaßt. Je nach (angeblicher) Wichtigkeit einer Komponente gibt der Zielbaum der entsprechenden Note ein bestimmtes Gewicht mit dem sie in die „Gesamtnote„ einfließt. Als Ergebnis des Zielbaums ergeben sich damit 2 „Durchschnittsnoten„. Eine für den Zustand im Anfangszeitpunkt und eine für den Zustand im Endzeitpunkt der Sanierung.
2. Differenzwertbildung mit Anfangswert und Multiplikator
Die Differenz, also die „Notenverbesserung„ wird dann in einen „Multiplikator„ umgerechnet. Dieser Multiplikator wird anschließend auf den außerhalb dieses Verfahrens ermittelten Bodenwert vor oder auch nach Sanierung angesetzt. Von Seldeneck/Dyroff gehen in ihrer Darstellung davon aus, daß ein Endwert vorhanden ist, bzw. außerhalb o. g. Verfahrens (durch den Gutachterausschuß) festgelegt wurde und dann ein Multiplikator kleiner 1 zur Ermittlung des Anfangswerts führt. Bei der vorzeitigen Entlassung jedoch sind zum maßgeblichen Zeitpunkt noch keine allgemeinen Endwerte ermittelt. Üblicherweise wird auch behauptet, es fänden sich nicht ausreichend ähnliche Verkaufsfälle, die eine individuelle Ermittlung im Vergleichswertverfahren ermöglichen würden. Daher wird auf die „Anfangswerte„ zurückgegriffen, die sich in den Bodenrichtwertkarten für die östlichen Sanierungsgebiete finden. Dies sind vom Gutachterausschuß mit den allgemeinen Änderungen der Wertverhältnisse fortgeschriebene Werte vom Sanierungsbeginn. Grob gesagt wird durch die Bezirksämter die (nach deren Auffassung) eingetretene Notenverbesserung in einen Faktor größer 1 umgerechnet. Dieser wird dann auf den Ausgangswert angesetzt, so daß sich der (fiktive) Endwert durch Multiplikation ergibt. Die Differenz wird als Ausgleichsbetrag erhoben.
Maßgeblich für den Endwert ist also insoweit der durch den Zielbaum und weitere Rechenschritte, die aber nur mehr den „Maßstab„, nicht die inhaltliche Richtung ändern, ermittelte „Multiplikator„. Ist dieser größer 1, so ergibt sich zwangsläufig
Endwert (= Anfangswert * Anfangswertmultiplikator) ist größer als Anfangswert
Der Multiplikator berechnet sich dabei nach der Formel
(1 – (0,25 * Normierte-Zielbaum-Note Endzustand) / (1-(0,25 * Normierte Zielbaum-Note Anfangszustand)
Nur wenn auch die rechtliche Situation des Grundstücks neu geordnet wurde (v. a. wenn eine höhere GFZ/bauliche Ausnutzung neu zulässig wird), kommt hierfür ein Ansatz hinzu. Beim Regelfall der östlichen Sanierungsgebiete ist dies nicht einschlägig. Vermindern kann sich der Ausgleichsbetrag noch durch einen in Folge aufstehender Bebauung eingeschränkten Nutzen aus der Bodenwerterhöhung („rentierlicher Bodenwertanteil„). Diese unten erläuterte Minderung ist aber eine prozentuale, die wie die sonstigen Rechenschritte allenfalls den Maßstab, nicht aber die Richtung ändert.
Mithin gilt, daß zumeist allein die Höhe der Durchschnittsnoten des Anfangs- und Endzustands, also die Summe der getroffenen Zustandseinschätzungen, die Bodenwerterhöhung bestimmt.
3. Maßnahmebodenwert und abgezinster Endwert
Bei der vorzeitigen Entlassung ergibt sich eine weitere Besonderheit: Da der „Endzustand„ mangels Abschluß der Sanierung noch nicht erreicht ist, kann die Endqualität nur prognostiziert werden. Die Verwaltung tendiert bei sich wehrenden Eigentümern dazu, das Schwergewicht auf solche künftige Verbesserungen zu legen. Denn wie gut oder schlecht der Zustand zum Zeitpunkt der Entlassung ist, kann durch tatsächliche Feststellungen überprüft und bewiesen werden. Die Endzustandsprognose ist weit schwieriger anzugreifen. Gleichwohl sollten etwa überzogene Prognosen nachhaltig hinterfragt werden. Denn es ist mittlerweile sogar fraglich, ob die Sanierung in den östlichen Bezirken nicht unvollendet abgebrochen wird, so daß überhaupt keine weitere Entwicklung berechnet werden dürfte: Im Mietermagazin Juni/Juli 2004 („Vor der Sanierung ist nach der Sanierung„) wird von Plänen der Senatsverwaltung berichtet, wegen Geldmangels die Sanierungsgebiete im Ostteil bereits 2005 oder 2006 aufzuheben. Dann wäre dieser „Endzustand„ anzusetzen.
Jedenfalls darf der Endzustand nicht unvermindert in Rechnung gestellt werden, da er ja erst später erreicht wird. Methodisch tritt daher zwischen den Ausgangs- und den Endwert ein sogenannter „Maßnahmebodenwert„:
Dazu werden 3 „Durchschnittsnoten„ ermittelt. Eine für den Anfangszustand, eine für den Zustand im Zeitpunkt der Entlassung (z.B. 2000) und eine für den (prognostizierten) Zustand im Zeitpunkt des allgemeinen Sanierungsabschlusses. Die Differenz zwischen dem nach obigem Muster per Multiplikation auf den Anfangswert ermittelten „Maßnahmebodenwert„ und dem Anfangswert wird 1 zu 1 in Rechnung gestellt. Die ebenso berechnete Differenz zwischen dem prognostizierten Endwert und dem Maßnahmebodenwert wird über die sogenannte „Wartezeit„ bis zum Erreichen des Endzustands (Aufhebung der Sanierungssatzung) abgezinst. Der Zinssatz beträgt nach der aktuellen AV-Ausgleichsbeträge 5 % p. a. Es ergibt sich daher die auszugleichende Bodenwertsteigerung mit:
(Maßnahmebodenwert – Anfangswert) + (Endwert – Maßnahmebodenwert) x 1/1,05 hoch Wartezeit
Der Satz von 5 % liegt nach Auffassung des Verfassers mittlerweile in den meisten Fällen unter dem Liegenschaftszinssatz des betreffenden Grundstücks und ist unzureichend. Würde die Vollziehung ausgesetzt, berechnete Berlin 6 % Zinsen, also mehr, als man zugunsten der Eigentümer ansetzt. Unabhängig von der Zinssatzhöhe gilt indes: Je größer die Wartezeit, um so stärker wirkt sich die Abzinsung aus. Selbst wenn also die Sanierungsgebiete bis zur Zielerreichung zu Ende geführt werden, fragt sich bis wann. Die Verwaltung prognostiziert derzeit den Endzeitpunkt auf einen Zeitpunkt, zu dem die Sanierung in Wahrheit nicht erfolgreich abgeschlossen sein kann, für das Sanierungsgebiet Kollwitzplatz z.B. auf 2010. Doch wurde in Berlin noch nie ein Sanierungsgebiet innerhalb von 17 Jahren festgesetzt und wieder aufgehoben, die von Sanierungsgeldern bezahlte Zeitschrift „VorOrt„ stellte bereits 1998 fest: „Die Aussagen der Verantwortlichen zu den weiter notwendigen Maßnahmen und den Finanzproblemen mit der daraus resultierenden Streckung der Entwicklung deuten eine Aufhebung nicht vor 2020 an.„
Der Unterschied ist beträchtlich: Wird der Endwert (bei Entlassung im Jahr 2000) in 2010 erreicht, so ist mit 1,05 hoch 10 abzuzinsen, die Wertdifferenz also durch 1,63 zu teilen. Wird der Endwert entsprechend der tatsächlichen Geltungsdauer aller bisher in Berlin aufgehobenen Sanierungssatzungen erst 2023 erreicht, so ist mit 1,05 hoch 23 abzuzinsen, wonach die Wertdifferenz durch 3,7 zu teilen ist.
Der „Endzustand„ bzw. der Ausgleichsbetrag sind zudem um einen Wagnis- und Pionierabschlag zu mindern. Der Wagnisabschlag betrifft die Gefahr, daß die Prognose nicht eintritt und muß um so höher sein, je unvorsichtiger diese ist. Der Pionierabschlag berücksichtigt, daß der bereits entlassene Eigentümer (der also sein Haus schon für viel Geld saniert hat) diese Investition zunächst nur eingeschränkt nutzen kann, da ihn die negativen Folgen der andauernden Sanierung (Baulärm…) behindern. Beides übersehen die Berliner Behörden häufig, obwohl sie nach BVerwG 4 C 6.01 vom 16.05.2002 (BauR 2002 S. 1811) zur Berücksichtigung verpflichtet sind.
4. Ausgleichsabgabe trotz gesunkener Bodenwerte
Gerade in den östlichen Bezirken sind die Grundstücke heute im Regelfall weniger wert, als zu Beginn der Sanierung. Bei der dargestellten Berechnung, die den Endwert durch Multiplikation auf den Anfangswert errechnet, kommt es aber zwangsläufig zu einer „Werterhöhung„. Dies ist im Grundsatz gesetzessystematisch korrekt, da der „Anfangswert„ wie nachfolgend zu erläutern ist, ein fiktiver Wert im Zeitpunkt des Abschlusses der Sanierung ist, und nicht etwa mit dem tatsächlichen (Nominal)wert zum Beginn der Sanierung gleichgesetzt werden darf.
5. Kritik am Zielbaum
Wie erläutert nimmt der „Zielbaum„ zum einen eine Gewichtung der verschiedenen Noten vor, was einer eingeschränkten gerichtlichen Überprüfung unterliegt, da es unmöglich ist, genau „die„ exakt richtige Gewichtung der Wertkomponenten vorzunehmen. Dennoch erscheint es rechtlich unhaltbar, daß für alle innerstädtischen Bezirke Berlins ein und derselbe Zielbaum gelten soll. Für ein x-beliebiges Grundstück im Sanierungsgebiet Winsstraße sollen die gleichen Kriterien in gleichem Umfang wertrelevant sein, wie etwa in Kreuzberg. Kultureinrichtungen im Sanierungsgebiet selbst sollen für einen zentrumsfernen Straßenzug nicht wichtiger sein, als für ein Grundstück, von dem aus man in kürzester Zeit zu Fuß zentrale Kultureinrichtungen wie die deutsche Oper oder die Museumsinsel erreicht. Dies ist offensichtlich unzutreffend und übersteigt m. E. den behördlichen Beurteilungsspielraum, da eine „Beurteilung„ im Einzelfall gar nicht erst stattfindet. Es wird eine offenkundig stark heterogene Masse Tausender von Grundstücken, verteilt über ein Stadtgebiet mit hunderttausenden von Grundstücken über einen Kamm geschoren.
Zudem legt der Zielbaum fest, welche Kriterien überhaupt als wertrelevant erfaßt werden. Und hier sind äußerste Zweifel angebracht, daß tatsächlich nur empirische Beobachtungen umgesetzt wurden. Denn politisch unerwünschte Wertkomponenten wie etwa der Anteil an Sozialwohnungen oder sonst subventionierten Wohnungen, das Bestehen von Mietobergrenzen und Belegungsbindungen sowie die Sozialstruktur der Bewohner werden nicht erfaßt. Dabei dürfte sich empirisch ein sehr starker Zusammenhang dahingehend zeigen, daß ein hoher Anteil an Sozialwohnungen oder sonst „preisbeeinflußten„ Wohnungen der gegenwärtigen Förderart zu niedrigeren Grundstückswerten führt. Soweit von Seldeneck/Dyroff auf das werterhöhende Moment der Wohnungsbauförderung hingewiesen haben, galt dies ersichtlich der seinerzeitig üppigen Förderpraxis, die Stadtvillen in Lichtenrade und selbst Dachgeschoßausbauten in Weißensee förderte, wenn sich der Vermieter nur zu einer Miete von maximal 10 Euro/m² verpflichtete. Auf die nunmehr gänzlich geänderte Förderpraxis bzw. die „soziale Stadterneuerung„ mit Mieten von 3 Euro/qm ist dies nicht übertragbar. Eine schwache Sozialstruktur (niedriges Durchschnittseinkommen) der Bewohner dürfte die mit den Grundstückswerten am stärksten korrelierte veränderliche Komponente sein. Doch da die Sanierungspolitik bewußt darauf ausgerichtet war, den Anteil an sozialgebundenen Wohnungen zu erhöhen und die Bewohnerstruktur vor Verdrängung zu schützen, ergäbe ein Einbezug dieser Kriterien negative „sanierungsbedingte Wertveränderungen„, würde man die Entwicklung ohne Sanierung mit der Entwicklung mit Sanierung i. S. der städtebaulichen Veranstaltung vergleichen. Ihr Weglassen dient fiskalisch politischen Zwecken, ist empirisch und damit rechtlich jedoch unhaltbar.
Dabei geht es mitnichten darum, zu bezweifeln, daß der Erhalt bestehender Bewohnerstrukturen und günstigen Wohnraums ein legitimes Politikziel sein kann. Doch bei dem Sanierungsausgleichsbetrag geht es allein um die finanzielle Frage einer Grundstückswerterhöhung. Im Hinblick auf die Sozialpflichtigkeit des Eigentums auferlegte Beschränkungen müssen hier Berücksichtigung finden. Verwaltungsvertreter, die allen Ernstes behaupten, Mietobergrenzen seien grundstückswerterhöhend, bedauern vermutlich auch die armen Grundstückseigentümer in New York, deren Grundstückswerte im Umkehrschluß zusammengebrochen sein müßten und glauben, das Mietniveau in den Innenstädten Münchens, Stuttgarts oder Frankfurts führe zur Verelendung der betroffenen Hauseigentümer.
6. Kernpunkt bei den aktuellen Festsetzungen: Der Bewertungsrahmen
6.1. Allgemeines
Abgesehen von diesen fragwürdigen (Nicht-)Wertungen des Zielbaums ist die für den Ausgleichsbetrag entscheidende Stellweiche die „Benotung„ der Zustände. Die Behörden erstellen dazu einen matrixartigen „Bewertungsrahmen„ gem. Nr. 6.5.3. der AV-Ausgleichsbeträge 2002. In diesen wird die zugleich erstellte textliche „städtebauliche Stellungnahme„ übertragen, indem den dort beschriebenen Zuständen „Noten„ zugewiesen werden. Seltsam mutet dabei zunächst an, daß die Beschreibung regelmäßig von Mitarbeitern des Sanierungsbeauftragten (meist BSM oder STERN) erstellt wird. Diese wirtschaftlich orientierten Gesellschaften, die von der Sanierungsbetreuung leben und deren Mitarbeiter darauf angewiesen sind, möglichst oft einen möglichst hohen Sanierungsbedarf festzustellen um diesen dann erfolgreich zu beseitigen, urteilen also über ihre eigene Arbeit. Erfreulicher Weise unterliegen die tatsächlichen Einordnungen in der Bewertungsmatrix voll der Kontrolle durch die Gerichte. Das BVerwG (BVerwG 4 C 6.01 vom 16.05.2002 BauR 2002 S. 1811 = ZfIR 2002, S. 918 – Leitsatz 4) stellt hierzu klar: „Wenn nach allgemeiner Auffassung bei der Bewertung von Grundstücksflächen ein Wertermittlungsspielraum anzuerkennen ist, so beruht dies darauf, daß die eigentliche Bewertung immer nur eine Schätzung darstellen kann und Erfahrung und Sachkunde voraussetzt, über die ein insoweit nicht sachkundiges Gericht weniger verfügt als die Mitglieder der Gutachterausschüsse. Ein derartiger Wertermittlungsspielraum ist jedoch auf diesen Bereich beschränkt. Er erstreckt sich nicht auf die rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen der Bewertung. Ob eine Bewertung auf zutreffenden Voraussetzungen beruht, dürfen die Verwaltungsgerichte in vollem Umfang prüfen; sie müssen es sogar, wenn die Beteiligten darüber streiten.„
Der erste und mitunter wichtigste Ansatzpunkt ist daher kritisch zu überprüfen, ob der tatsächliche Zustand im Anfangszeitpunkt so schlecht war, gegenwärtig (Maßnahmebodenwert) so gut ist und zukünftig (Endzustand) so phantastisch sein wird, wie behauptet.
6.2. Der Begriff „sanierungsbedingt„.
6.2.1. Grundsätze
Dreh- und Angelpunkt für eine Prüfung ist die Eliminierung nicht sanierungsbedingter Änderungen. Wird durch den Gutachterausschuß ein korrekter Anfangswert– also der mit den allgemeinen Veränderungen der Wertverhältnisse fortgeschriebene historische Wert – und auch tatsächlicher Endwert ermittelt, so ist dies zumindest modelltheoretisch sichergestellt. Wird aber nur der Anfangs- oder Endwert zur Grundlage genommen und der jeweils andere fiktiv durch einen „Faktor„ auf diesen berechnet, so ist unabdingbar, daß bei Ermittlung des „Faktors„ über die Komponentenlösung nur solche Veränderungen in den Bewertungsrahmen Eingang finden, die sanierungsbedingt sind.
Wenn also wie im Fall der östlichen Berliner Sanierungsgebiete derzeit ein Aufschlag auf die Anfangswerte zur Endwertermittlung vorgenommen wird, so darf in diesem Aufschlag nichts enthalten sein, was nicht sanierungsbedingt ist. Ein Beispiel: Die Grundstückspreise erhöhen sich allgemein im Zentrum Berlins um 10 %, weil die Luft in Berlin sauberer wird und mehr Menschen aus dem Umland wieder in die Innenstadt ziehen. Diese allgemeine Entwicklung berücksichtigt der Gutachterausschuß, in dem er den „Anfangswert„ entsprechend (z.B. von 1.000 Euro auf 1.100 Euro/m²) erhöht. Wenn aber dann das Bezirksamt die (auch im Sanierungsgebiet eingetretene) Luftverbesserung in sein Komponentenmodell einbezieht, in dem es die Komponente 9 „Luft und Lärmbelastung„ im Anfangszeitpunkt als erheblich (Note 4) und am Ende nur mehr als gering (Note 2) einstuft, so erhöht sich nach o. g. Berechnung über Zielbaum etc. der „Anfangswertmultiplikator„. Wird dieser erhöhte Multiplikator dann auf den (ohnehin durch den Gutachterausschuß erhöhten) Anfangswert angesetzt, so potenziert sich der Effekt im Beispiel zu 1.100 * 1,1 = 1210. Der angebliche „Wertgewinn„ läge also bei 110 Euro/m². Damit ist zugleich eine weitere rechtswidrige Schwäche des „Anfangswertmultiplikators„ aufgezeigt: Die eingetretene „sanierungsbedingte„ Bodenwerterhöhung ist um so größer, je höher die allgemeinen Verbesserungen/Wertänderungen sind. Das Hochindexieren des Anfangswertes durch den Gutachterausschuß, das eigentlich zu Gunsten des Eigentümers verhindern soll, daß er mit externen Effekten belastet wird, erhöht tatsächlich zu seinen Lasten den abzuschöpfenden Wertgewinn.
Will man Entwicklungen, die auch ohne die städtebauliche Veranstaltung „Sanierung„ stattgefunden hätten, gesetzeskonform herausrechnen, so muß das Bezirksamt bei der Notenvergabe für den Anfangszustand nicht den historisch-tatsächlichen Zustand (schlechte Luft) betrachten, sondern den um allgemein eingetretene Veränderungen fortgeschriebenen Zustand (verbesserte Luft) benoten. Denn dies ist der Zustand „der auch ohne Sanierung eingetreten wäre„. Das Bezirksamt müßte also „A„ und „E„ mit Note 2 bewerten. Alle Verbesserungen, für die die Sanierung i.S.d. städtebaulichen Veranstaltung nicht Bedingung waren, müssen bereits beim Anfangswert „gutgebracht„ werden.
6.2.2. Praxis der Bezirksämter in den östlichen Bezirken
Im Ostteil Berlins – so möchte man meinen – läge diese Notwendigkeit wegen der Umbrüche im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung auch für die Behörden auf der Hand. Doch die dortigen Ämter rechnen 100 % der tatsächlichen Veränderungen als sanierungsbedingt in die Festsetzung des Ausgleichsbetrages ein. Die Note für „A„ wird durch unkorrigierte Bewertung des historischen Zustands im gewählten Ausgangszeitpunkt vergeben, die Note für „E„ durch unkorrigierte Bewertung des (prognostizierten) Zustands im Endzeitpunkt. Man hält gleichsam ein Foto von 1990 neben ein Foto von 2010, bewertet beide für sich und berechnet die Differenz. Z.B. im Sanierungsgebiet Kollwitzplatz wird dabei der Anfangswert /Anfangszustand auf den 29.11.1990 festgesetzt, also wenige Wochen nach der Wiedervereinigung. Alles was sich seither bis zum angeblichen Endzeitpunkt 2010 verändert, soll eine sanierungsbedingte Wohltat der Sanierungsverwaltung und damit eine abzuschöpfende sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung sein.
Dabei ist offensichtlich, daß in Folge der Wiedervereinigung der Zustand von 1990 auch ohne Sanierungssatzung nicht unverändert bleiben würde. Kein Gebiet – ob Sanierungsgebiet oder nicht – in den neuen Ländern und dem Ostteil Berlins sieht 2010 so aus wie 1990. Dies ist eine zwangsläufige Folge des grundgesetzlichen Gebotes einheitlicher Lebensbedingungen und der freien Marktwirtschaft. Es lastete tatsächlich ein hoher Investitionsdruck auf den betroffenen Gebieten und nur zur Erreichung der vorrangig „sozialen Sanierungsziele„ (Verhinderung von Mietpreissprüngen, Schutz des angestammten „Milieus„ etc.) wurden die Mittel des besonderen Städtebaurechte benötigt und benutzt. Die Sanierungsverwaltung hat mit Mietobergrenzen, Verzögerungen und Auflagen die wirtschaftliche Entwicklung behindert und Investoren gehemmt. Doch die Sanierungsämter sehen dies anders. Eine Rücksprache mit mehreren Berliner Juristenkollegen bestätigte, daß es allgemeine Praxis ist, 100 % der Zustandsveränderungen auch im Falle des Ostteils Berlins als sanierungsbedingt anzusehen.
6.2.3. Argumentation der Verwaltung - Stand der Rechtswissenschaft
Die Verwaltung stützt sich dabei auf die These, ein Sanierungsgebiet sei ja nur deshalb festgesetzt worden, weil ohne diese Festsetzung keine positive Gebietsentwicklung erwartet hätte werden können. Daher sei alles Geschehene „sanierungsbedingt„. Dabei wird zum einen verdrängt, daß ein Großteil der Festsetzungsbegründungen aus „sozialen„ Zielen bestand: Die vorzunehmende Modernisierung sollte sozial gerecht ablaufen, der freie Markt sollte beschränkt werden. Zum anderen werden Rechtsmeinungen verschiedener Fachleute unberechtigt in Anspruch genommen, wenn unter Berufung auf diese etwa behauptet wird, allein der Umstand, daß eine Sanierungssatzung festgesetzt wurde, belege bereits, daß ohne Sanierung nichts vorangegangen wäre, weil dies Tatbestandsvoraussetzung für eine (rechtmäßige) Sanierungsfestsetzung sei. Eine „Was-wäre-ohne-Sanierung„-Entwicklung sei daher nicht zu eliminieren. Dies scheint mit Kommentierungen z. B. von Prof. Wolfgang Kleiber übereinzustimmen.
Doch diese Inanspruchnahme von Kleiber ist falsch. Kleiber lehnt die AV Ausgleichsbeträge und das Herumexperimentieren mit einem Ersten, Zweiten (und Dritten) Berliner Modell entschieden ab. Das Verfahren könne noch nicht einmal von Fachleuten nachvollzogen werden. „Die Höhe des Ausgleichsbetrags bemißt sich nach den gesetzlichen Vorgaben aus der Differenz zweier Verkehrswerte und nicht nach theoretischen Modellvorgaben und ex cathedra zahlenmäßig vorgegebenen Parametern einer Verwaltungsbehörde. Modelltheoretisch kann aus einer schulnotenmäßig abgeleiteten Verhältniszahl zum Zustand eines Grundstücks vor und nach Sanierung und ihrer Anwendung auf den sanierungsunbeeinflußten Anfangswert auch gar nicht erwartet werden, daß sie zum Endwert führt, solange dieses Modell nicht maßstabsmäßig an den Endwert justiert wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn in diese Verhältniszahl auch Änderungen eingehen sollen, die nicht sanierungsbedingt sind„, so Kleiber in einer Stellungnahme gegenüber dem Verfasser. Denn natürlich gebe es Änderungen, die auch außerhalb von Sanierungsgebieten das allgemeine Marktgeschehen beeinflussen. Daher berücksichtigten Bodenpreisindexreihen durch eine hochindizierte Anfangsqualität die sich allgemein auch außerhalb von Sanierungsgebieten vollziehenden Verbesserungen.
Nach Auffassung des Verfassers entspricht die Berücksichtigung einer „was wäre ohne Sanierung passiert„-Entwicklung bereits dem Wortlaut des § 154 Abs. 2 BauGB der ausdrücklich einen „was wäre wenn„ –Vergleich vorgibt, wenn es dort eben heißt, Anfangswert sei: „der Bodenwert, der sich ergeben würde, wenn eine Sanierung weder beabsichtigt noch durchgeführt worden wäre„. Die Reduzierung dieser Aussage auf einen „Bodenwert von heute im Anfangszustand„ und die Definition des letzteren als faktisch unverändert wäre nämlich ein Zirkelschluß. § 154 Abs. 2 BauGB definiert gerade auch diesen „Anfangszustand„, er darf nicht innerhalb der Definition als (anderweitig definiert) vorausgesetzt werden. Denn dem „Wert der sich ergeben würde„ ist der Zustand der sich ergeben würde immanent, da Zustand und allgemeine Wertverhältnisse 2 Komponenten sind, die erst zusammen den „Wert„ ergeben. Keinesfalls läßt sich vertreten, der Wortlaut des § 154 Abs. 2 BauGB verbiete eine solche Interpretation. Läßt der Wortlaut eine Interpretation im Sinne des Verfassers zu, so ist Art. 3 I GG zu beachten, der eine Interpretation gebietet, die eine fiktive Entwicklung auch ohne Sanierung berücksichtigt: Denn würden etwa die Sanierungsgebiete in den neuen Ländern und dem Ostteil Berlins insoweit mit klassischen Sanierungsgebieten im Westen gleichbehandelt, also auch für sie unterstellt, daß sich ohne Sanierung nichts gebessert hätte, so würde wesentlich ungleiches rechtswidrig gleich behandelt. Für Westberlin hat in Folge der vereinigungsbedingten Besonderheiten das Gleiche zu gelten, soweit es um Veränderungen nach 1990 geht. Und wo wäre die Eliminierung nicht sanierungsbedingter Elemente technisch besser verortet, als bei der Definition der Ausgangsqualität durch entsprechende Auslegung der Anfangswertdefinition? Allerdings ist die Verortung nicht entscheidend: Will man nicht den Anfangswert modifizieren, so bleibt der Prüfungspunkt „sanierungsbedingt„ gleichwohl bestehen und nicht sanierungsbedingte Entwicklungen sind an anderer Stelle auszuklammern.
Die Behörden mißinterpretieren die Kommentierung in Ernst-Zinkahn-Bielenberg § 153 BauGB Rn. 61 ff. Zwar wird dort für 153 BauGB, der nach seinem Wortlaut anders als § 154 BauGB keinen „Was-Wäre-Wenn-Vergleich vorschreibt, die Berücksichtigung einer „Wäre-wenn-Entwicklung„ vordergründig als angebliche Mindermeinung abgelehnt. Doch darf diese Aussage nicht sinnentleert werden, in dem sie von ihrer Begründung getrennt wird. Diese lautet (§ 153 BauGB Rn. 63): „Sie (die Entschädigungsqualität) muß schon deshalb fixiert bleiben, weil nach den Anwendungsvoraussetzungen des Besonderen Städtebaurechts … nicht mit einer selbständigen qualitativen Weiterentwicklung gerechnet werden konnte (conditio sine qua non)„. Diese Aussage paßt für die neuen Bundesländer offensichtlich nicht, da hier Sanierungsgebiete festgesetzt wurden, wenn ohne Festsetzung z.B. nicht mit der gewünschten „sozialen„ Sanierung gerechnet werden konnte oder wegen der großen Aufgaben eine beschleunigte Entwicklung angestrebt wurde, dagegen nicht nur, wenn überhaupt keine bauliche Sanierung/Standardverbesserung erwartet werden konnte. Nur letztere aber stellt die Berliner Verwaltung im Zielbaum als sanierungsbedingt in Rechnung (weniger Podesttoiletten, Ofenheizungen…). Solche vorwiegend sozialpolitisch motivierten Modernisierungs- und Instandsetzungsgebiete waren bislang nicht nach § 154 BauGB zu beurteilen, da erst jetzt die ersten Abrechnungen hierfür anstehen. Weiter wird in der gesamten Literatur zumindest eben diese „Conditio sine qua non„ gefordert, also mindestens, „daß ohne das Sanierungs- bzw. Entwicklungsunternehmen die STÄDTEBAULICHE Sanierung bzw. Entwicklung in absehbarer Zeit nicht erwartet werden kann.„ „Absehbare Zeit„ muß dabei offensichtlich jedenfalls der Zeitraum sein, den auch die städtebauliche Sanierung in Anspruch nimmt, da ja ihr Nutzen (Beschleunigung…) zu beurteilen ist. Auch diese Prämisse wird in den neuen Ländern und Berlins östlichen Bezirken nicht erfüllt, da zwischen 1990 und 2010 (Mindestlaufzeit der Sanierungsgebiete) sehr wohl eine Entwicklung zu erwarten war – erst recht in der Mitte der deutschen Hauptstadt. Schon allein jeder einzelne Straßenzug neben den Sanierungsgebieten mit ihren oft eher willkürlichen Rändern belegt dies. Kleiber in Ernst-Zinkahn-Bielenberg § 153 BauGB Rn. 61 ff. und die dortigen weiteren Nachweise beurteilen eine städtebauliche Entwicklung in einem Devestitionsgebiet, das trotz Jahrzehnten der Marktwirtschaft nicht vorankommt und nun gründlich umgestaltet wird. Sie meinen nicht Wohnquartiere, die in der DDR systembedingt verkamen und nun lediglich baulich instand gesetzt werden. Der Unterschied wird vollends deutlich, wenn Kleiber unter Bezug auf Janning (Bodenwert und Städtebaurecht, 1976, S. 95 ff.) formuliert: „Solche nicht hinwegdenkbaren Bedingungen„ seien „Bauleitplanung, Bodenordnung, Erschließungs- und Folgeeinrichtungen, also Maßnahmen, die nach § 136 ff. BauGB Grundelemente städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sind„. Denn wo bitte sind diese Grundelemente in Sanierungsgebieten wie dem Kollwitzplatz oder der Spandauer Vorstadt? Wo hat dort Bauleitplanung oder Bodenordnung stattgefunden, welche Erschließungsanlagen wurden (mehr als im Ostteil vereinigungsbedingt üblich) erneuert, geschweige denn neu geschaffen? Es mag sein, daß bei der Festlegung der Sanierungsziele solche klassischen Maßnahmen geplant waren und eine überdurchschnittlich gute Entwicklung angestrebt wurde. Doch diese Maßnahmen und Ziele sind aus Geldmangel zum Großteil schon offiziell gestrichen, der Rest wird der fehlenden Finanzierung auch noch zum Opfer fallen. In den östlichen Bezirken geht es in praxi lediglich um Instandsetzung und Modernisierung, nicht um die Schaffung neuer Strukturen.
Der Kernsatz von Kleiber (Rn. 65) lautet schließlich „Aus den dargelegten Gründen ist es unzulässig, bei der Ermittlung des entwicklungsunbeeinflußten Grundstückswerts werterhöhend zu berücksichtigen, daß auch ohne Einleitung der Entwicklungsmaßnahme – allein auf Grundlage des allgemeinen Städtebaurechts – eine Werterhöhung im Veranstaltungsgebiet eingetreten sein würde„. Eine „allein auf Grundlage des allgemeinen Städtebaurechts„ beruhende allgemeine Entwicklung (im Bereich Bodenordnung, Bauleitplanung, Infrastruktur!) soll also nach dieser Auffassung nicht unterstellt werden dürfen. Die Wiedervereinigung mit ihren Systemumwälzungen und die erstmalige Geltung des grundgesetzlichen Gebots einheitlicher Lebensverhältnisse auch im Ostteil Berlins können aber wohl kaum als „allgemeines Städtebaurecht„ bezeichnet werden. Wer also – wie der Verfasser – fordert, eine „Was-wäre-wenn-Entwicklung„ in den neuen Ländern und dem Ostteil Berlins zu berücksichtigen, behauptet alles andere als „nur auf Grundlage des allgemeinen Städtebaurechts„ eingetretene Entwicklungen. Die offensichtlich allein vor dem Hintergrund westdeutscher Sanierungsgebiete, in denen der Markt „am Ende„ war und die nur mit staatlichen Mitteln großflächig neu geordnet wurden, getroffenen Aussagen werden mißbraucht, will man Sie für eine Außerachtlassung der allgemeinen Fortentwicklung im Beitrittsgebiet in Folge der Wiedervereinigung heranziehen. Diese Aussagen sind bezogen auf vom freien Markt vernachlässigte Gebiete, in denen Fußgängerzonen und Parks entstanden, auf Industriebrachen, die zu Wohnquartieren wurden. Nicht bezogen sind sie auf das Neutünchen Sozialismus-verfallener Fassaden am Kollwitzplatz oder das Verschwinden von Ofenheizungen in der Hauptstadt eines der reichsten Länder der Welt bis 2010. Daher gibt es (soweit dem Verfasser bekannt) nicht einen einzigen Fachbeitrag der fordert, die wiedervereinigungsbedingten Veränderungen zwischen 1990 und 2020 als „sanierungsbedingt„ anzusehen.
Grundsätzlich scheinen i. ü. generelle Zweifel an o. g. Argumentation angebracht, da es sich um einen staatsgläubigen Zirkelschluß handelt, der letztlich lautet: „Was nicht sein darf (Sanierungssatzung trotz milderer/anderer Mittel zur Zielerreichung) kann nicht sein„. Solche Zirkelschlüsse aber sind keine objektiv tragfähige Argumentation. Dies gilt zumal dann, wenn man betrachtet, wie viele rechtswidrige Festsetzungen bzgl. Sanierungsgebiete die Berliner Verwaltung in den letzten Jahren zu Stande gebracht hat. Allein der Umstand also, daß sich niemand gegen die Sanierungssatzung gewehrt hat, heißt noch lange nicht, daß diese rechtmäßig festgesetzt worden ist.
6.2.4 Belege für eine Entwicklung auch ohne Sanierungsgebiete
Für die These, daß es insbesondere in vielen Ostberliner Sanierungsgebieten auch ohne Sanierungssatzung zu großen Investitionen gekommen wäre, während die „Sanierungsziele„ die Investoren ausbremsen sollten und öffentliche Mittel allein auf die „soziale Erneuerung„ konzentriert wurden, gibt es eine Vielzahl entsprechender Belege. Als Argumentationshilfe seien einige hier genant:
Andrey Holm, Mieterecho 1998:
„Denn in Ostberlin hat sich ein tief greifender Wandel der Sanierungspolitik vollzogen - sie ist zunehmend unsozial, da Stadterneuerung in Ostberlin trotz der riesigen Investitionsunterlassungen nicht in einem 'klassischen Desinvestitionsgebiet' durchgeführt wird, sondern unter einem teilweise enormen Verwertungs- und Nachfragedruck stattfindet. Viele Altbauviertel in Ostberlin (Spandauer Vorstadt, Kollwitzplatz) sind auch bei besserverdienenden Haushalten eine attraktive Wohnadresse geworden. Soziale Zielsetzungen der Erneuerung können nicht mehr durch Investitionsstimuli für „dezidiert nichtkapitalistische" Akteure der Stadtentwicklung (Welsch-Guerra 1992: 37) durchgesetzt werden, sondern nur als Gegensteuerung zu renditeorientierten Investitionen.„
Sanierungszeitschrift „Vor Ort„ Mai 2000 – Mieterberatung Prenzlauer Berg:
„Wie könnten ohne Mietobergrenzen die vom Senat beschlossenen Sanierungsziele "Schutz der Wohnbevölkerung vor Verdrängung" und "Vermeidung sozialer Segregation" umgesetzt werden? Und wie könnte ein großflächiger Austausch von Bewohnern durch überteuerte Modernisierungen in den bevorzugten Lagen von Prenzlauer Berg, oder Mitte verhindert werden? Während derzeit die spekulativ erhöhten Grundstückspreise deutlich zurückgehen und damit eine maßvolle Modernisierung wieder ermöglicht wird, müßten bei einem Wegfall von Mietobergrenzen Grundstückspreise gezahlt werden, die sozial verträgliche Mieten nach Modernisierung gar nicht mehr zulassen.„
Das Verwaltungsgericht Berlin:
„Mietobergrenzen haben die Zahl privater Sanierungen drastisch reduziert„ (GE 5/2001).
Die Statistik des Senats:
Von 1993-2000 wurden 65,3 % aller aufgewendeten Mittel im Programm „Soziale Stadterneuerung„ aufgewendet.
http://www2.rz.hu-berlin.de/stadtsoz/Forschung/Daten%20Prenzlauer%20Berg.pdf
Der in Pankow verantwortliche Stadtrat (Mietermagazin März 2002):
„Vor allem in attraktiven Lagen wie der Spandauer Vorstadt in Mitte oder am Kollwitzplatz in Prenzlauer Berg wurde die bauliche Sanierung zum Selbstläufer. Der Druck auf die Mieter wurde deshalb stärker. Um sie vor Verdrängung zu schützen, wurden Mietobergrenzen, Belegungsbindungen und Sozialplanverfahren eingeführt. Zahlen aus Prenzlauer Berg besagen, daß bei öffentlich geförderten Sanierungsmaßnahmen 70 Prozent der Bewohner in den Häusern verbleiben, bei freifinanzierten nur 50 Prozent. "Die öffentliche Förderung der sozialen Stadterneuerung ist unerläßlich, um auch die sozialen Sanierungsziele durchzusetzen", folgerte Andreas Bossmann (für PDS), bisheriger Pankower Stadtrat für Stadtentwicklung und Soziales.„
Der Senat:
„Wegen seiner citynahen Lage und der bekannten Kulturszene besitzt das Gebiet für Investoren und Touristen eine hohe Attraktivität„ (http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/stadterneuerung/de/kollwitz/index.shtml)
Die Mieterzeitschrift Scheinschlag:
„Die erneuerungsbedürftige Bausubstanz war weitaus umfangreicher, gleichzeitig stand weniger Geld für die Stadterneuerung zur Verfügung. Statt nur mit öffentlichen Geldern zu sanieren, konnte der Senat lediglich versuchen, mit Fördergeldern die Investitionen der privaten Hauseigentümer anzukurbeln. Doch das wäre gar nicht überall nötig gewesen, denn anders als im Kreuzberg der 80er Jahre, wo sich Investitionen in alte Wohnhäuser für den Eigentümer kaum lohnten, herrscht im Osten im Hauptstadt- und Metropolenrausch ein hoher Investitionsdruck, der vor allem auf der Spandauer Vorstadt und dem Kollwitzplatz lastet.„ (http://www.scheinschlagonline.de/archiv/1998/24_1998/texte/news01.html)
Eine vom Senat in Auftrag gegebene Studie der Humboldt Universität:
„Das Verkaufsverhalten der Alteigentümer war in Prenzlauer Berg aber kein Hindernis bei der Gewinnung von Investoren für die Altbausanierung. Das Fördergebietsgesetz und die aus Lage und Image herrührende Attraktivität des Gebietes riefen eine vergleichsweise große Nachfrage privater und professioneller Akteure auf den Plan„ Lediglich die Rechtsunsicherheit durch die Restitutionsverfahren hat bis 1993 zu einer Blockade geführt, die starke Steigerung bis 1996 spiegelt einzig und allein die Lösung dieses Problems wieder Häußermann/Glock/Keller http://www2.rz.hu-berlin.de/stadtsoz/Forschung/wp_02.pdf S. 13ff.
Eine Studie der DFG mit Untersuchungsobjekt Prenzlauer Berg:
„Der Wandel in Prenzlauer Berg war a. auf Grund der Transformation der Eigentumsstruktur, b. wegen der allgemein akzeptierten Notwendigkeit von Investitionen und c. durch die kulturelle Neubewertung des Bezirks nach der Wende unausweichlich„. http://www2.rz.hu-berlin.de/stadtsoz/Forschung/ErgebnissePB.PDF
Hingewiesen sei auch auf die „Topos-Studien„ von 1991(Prenzlauer Berg) 1993 (Prenzlauer Berg), 1994 (Östliche Sanierungsgebiete) und vor allem 1996 (Prenzlauer Berg „Milieu„), die eine starke Wirtschaftsdynamik belegen, die „gebremst„ werden muß, um eine „gentrification„ (Austausch der Bewohnerstruktur) zu verhindern.
6.3. Zu den einzelnen Feldern des Bewertungsrahmens gem. AV-Ausgleichsbeträge 2002:
In Stichpunkten seien einzelne Felder und Fehleinordnungen genannt, die dem Verfasser als besonders kritisch bekannt wurden. Die Punkte sind alles andere als abschließend und können nur als Ideenfundus dienen:
Lagekriterium 1 – Stadtbild – 1.1. Erscheinungsbild: Hier wird häufig bereits bei einem Sanierungsdurchgriff von 50 % ein „durchschnittliches Erscheinungsbild„, bzw. bei 70 % eine „gute Situation„ behauptet. Maßstab ist angesichts des einheitlich geltenden Zielbaums aber das Zentrum Berlins – Ost wie West. Maßstab ist angesichts der Methodologie des Zielbaums zudem die Innenstadt insgesamt, nicht nur Sanierungsgebiete. Und daß 50 % verfallene Fassaden eines DDR-Altbauviertels als „durchschnittlich„ auch für Wilmersdorf oder Charlottenburg gelten sollen, kann nicht vertreten werden.
1.2. Nutzungskonflikte: Häufig wird nicht eine einzige gewerbliche oder sonst störende Nutzung sanierungsbedingt beseitigt. Industrieanlagen im Ostteil fielen regelmäßig der Marktwirtschaft und nicht dem Sanierungsamt zum Opfer.
Lagekriterium 2 – Bebauungsdichte: Gerade in den östlichen Bezirken erfolgt kaum ein Abriß. Selbst marodeste Seitenflügel wurden bzw. werden mit staatlichen Mitteln erhalten, um billigen Wohnraum anbieten zu können. Dann kommt aber eher eine Verschlechterung durch die Maßnahmen der Sanierungsverwaltung als eine Verbesserung in Betracht. Nur wenn konkrete, sanierungsbedingte Abrisse benannt werden können, die sich auf das Grundstück auswirken, kommt eine positive Notendifferenz in Betracht. Sanierungsbedingte Neubauten (Sozialer Wohnungsbau…) sind andererseits als Verdichtung zu berücksichtigen. Bleibt man im System der Verwaltung (100 % der Geschehnisse sanierungsbedingt) sind auch alle sonstigen Lückenschlüsse und Dachgeschoßausbauten etc. anzusetzen, was zu einer negativen Entwicklung führt.
Lagekriterium 3 – Erneuerungsbedarf: Hier gilt das zu 1.1 gesagte.
Lagekriterium 4 – Ausstattung der Wohnungen: Hier ist besonders zu fragen, ob tatsächlich das Verschwinden von Ofenheizungen und Außentoiletten allein durch städtebauliche Maßnahmen bedingt ist. Denn die Behörde behauptet damit, daß ohne ihr Wirken auch 2010 oder später mitten in Berlin noch 70 % der Wohnungen kein Bad und Ofenheizung hätten. Zudem wird häufig die Note 5 („hoher Anteil an OH/PT oder AWC„) vergeben und dabei übersehen, daß dafür ein hoher Anteil (d.h. mehr als 50 %) der Wohnungen Ofenheizungen UND zugleich Podesttoilette oder Außenklo haben mußte. Denn eine mehrheitliche Ausstattung mit Ofenheizung aber Innentoilette (und ohne Bad) wird durch Note/Feld 4 erfaßt.
Lagekriterium 5 – Bodenordnende Maßnahmen: Häufig findet gar keine Bodenordnung durch die Sanierungsverwaltung statt. Zwangsmittel werden nicht eingesetzt, Geld für Ankäufe oder Enteignungen ist auch gar nicht vorhanden. Zudem ist der Bedarf an einer Neuordnung angesichts bereits vor 100 Jahren gut geordneter Wohngebiete in den zentralen Bezirken kaum vorhanden.
Lagekriterium 6 – Aufenthalts- und Gestaltungsqualität des Straßenraums: Der Zustand der Straßen in den östlichen Bezirken, das Fehlen von Straßenbegleitgrün und z.B. der Kampf des Pankower Bezirksamts gegen Fassadenbegrünungen lassen sanierungsbedingte Verbesserungen zu einer „guten„ Situation, wie sie meist behauptet wird, nicht gerechtfertigt erscheinen. Wo Straßenzustände verbessert wurden, ist besonders zu prüfen, mit welchen Mitteln und in welchem Rahmen. In den seltensten Fällen dürften die Maßnahmen solche im Zusammenhang mit der Sanierungssatzung sein.
Lagekriterium 7 – Öffentliche Grün- und Freiflächen: Der Anfangszustand wird häufig in %-Versorgungsgrad und entsprechend schlecht bewertet. Dann werden pauschal Verbesserungen behauptet, ohne einen Versorgungsgrad im Endzustand anzugeben und diesen dann einzuwerten. Marginale oder auch gar keine neuen Grünflächen sollen so Verbesserungen rechtfertigen, während der (in zentralen Lagen stets zu geringe) %-Versorgungsgrad eine möglichst schlechte Ausgangsnote sichert. Hier ist eine einheitliche Methodik zu fordern, die den Endwert beim Anfangswert ansiedeln dürfte. Denn die großen und damit Versorgungsgradprägenden Parks haben sich nicht verändert.
Lagekriterium 8 – Private Freiflächen: Irgendein Einfluß der Sanierungsverwaltung neben den allgemeinen Auflagen der Berliner Bauordnung bzgl. Hofentsiegelung und privater Spielplätze ist nicht erkennbar.
Lagekriterium 9 – Luft- und Lärmbelastung: Der PKW-Verkehr dürfte häufig deutlich zugenommen haben. Einzig reduziert dürften die Abgase aus Heizungsbrand sein. Wieder stellt sich die Frage, ob das Verschwinden der Ofenheizungen sanierungsbedingt ist. Hinzu kommt, daß die Luft in den meisten Sanierungsgebieten gegenwärtig schlechter ist, als durch die in Kürze (01.01.2005) greifenden europarechtlichen Vorgaben vorgeschrieben. Wenn aber ein (europarechtlicher) Anspruch auf eine bestimmte Luftqualität besteht, so ist dies eine allgemeine und keine sanierungsbedingte Entwicklung. Der „Luftreinhalteplan„, den der Senat etwa im November vorlegen will, gilt für ganz Berlin. Damit scheidet eine Qualifikation als „sanierungsbedingt„ aus, da auch ohne Sanierungsgebiet das zwingende Europarecht einzuhalten wäre.
Lagekriterium 10 – öffentliche Infrastruktur: (Schulen, Kindergärten etc.): Anders als beim Kriterium 7 werden hier häufig keine konkreten Maßnahmen genannt, sondern hier soll nun der künftig bessere %-Versorgungsgrad maßgeblich sein. Die einfache Erklärung: Es wurden Schulen und Kindergärten geschlossen, da aber in noch größerem Umfang die Zahl der Kinder zurückgeht, verbessert sich die %-Versorgungsrate. Der Geburtenrückgang soll also eine Segnung des besonderen Städtebaus sein. Abgesehen davon, daß Geburtenrückgang bzw. Familienwegzug Belege für das Scheitern der Sanierungsämter sind, hieße eine Wertung als sanierungsbedingt, daß sich das Sanierungsamt den Familienwegzug als zu bezahlenden Erfolg auf die Fahnen schreibt.
Lagekriterium 11 – Verkehrssituation: Wer wie die Behörde unkorrigiert zwei historische Zustände vergleicht, wird hier häufig zu einer wesentlichen Verschlechterung bei der Stellplatzsituation kommen müssen. Der (mit der Behördenauffassung „sanierungsbedingt„) erhöhte Verkehr führt erstmals zu einer Reihe von Nutzungskonflikten (zugeparkte Straßen als Gefahr für Fußgänger etc.), die durch ein paar neue Ampeln nicht aufgewogen werden.
Lagekriterium 12 – Einzelhandel, Dienstleistungen und Kultur: Hier ist wieder die Frage „sanierungsbedingt„ in Ostberlin besonders offensichtlich. Nach 1990 neu entstandene Supermärkte sind regelmäßig vom Sanierungsamt lediglich „nicht erfolgreich verhindert„, nicht dagegen gefördert worden. Aldi & Co. sind aus wirtschaftlichen Gründen in ganz Deutschland, nicht wegen der freundlichen Mitarbeiter in der Sanierungsverwaltung. Bei den kulturellen Einrichtungen ist zu fragen, ob hier tatsächlich nur auf das Sanierungsgebiet abzustellen ist, selbst wenn das betreffende Grundstück z.B. näher an „Unter den Linden„ liegt, als an der Kulturbrauerei. Auch fragt sich, welchen nennenswerten finanziellen Zusatzwert eine bezirkliche Kultureinrichtung für ein Grundstück haben kann, das etwa in Gehweite der „Hauptstadtkultur„ liegt. Nach der Lehre vom „Grenznutzen„ dürfte sich hier tatsächlich kein nennenswerter Werteffekt mehr ergeben.
6.4. Die tatsächlichen Auswirkungen der „sozialen Sanierung„
Es sei nochmals klargestellt, daß das Setzen von sozialen Zielen beim Stadtumbau Ost ein richtiger, notwendiger Schritt war. Daher geht es auch nicht darum, das Bemühen von Senat und Bezirken zu kritisieren, die bestehenden Bewohnerstrukturen im Zentrum Berlins vor Verdrängung zu schützen und lieber billigen Wohnraum als „Schicki-Micki„ Viertel zu befördern. Doch bei der im Rahmen des Sanierungsausgleichsbetrages allein gebotenen finanziellen Betrachtung ist festzustellen, daß es gerade in den zentral gelegenen Sanierungsgebieten wie der Spandauer Vorstadt oder dem Kollwitzplatz ohne Sanierungssatzung zu einer für die Grundstückseigentümer attraktiveren Situation gekommen wäre. Es kann nicht richtig sein, zu behaupten, man habe hunderte Millionen in die „soziale Stadterneuerung„ investieren müssen, um vor Verdrängung und überteuerten Sanierungen zu schützen, und gleichzeitig zu behaupten, ohne Sanierungssatzung hätten keine Modernisierungen durch Private stattgefunden. Die „Topos-Studien„ von 1991(Prenzlauer Berg) 1993 (Prenzlauer Berg), 1994 (Östliche Sanierungsgebiete) und vor allem 1996 (Prenzlauer Berg „Milieu„) belegen, daß es z.B. im Bereich Kollwitzplatz zu massiven Investitionen (und einer Verdrängung von finanziell schwächeren Schichten) gekommen wäre. Milieuschutzsatzungen in angrenzenden Gebieten wurden gerade mit dieser Erkenntnis begründet, soziale Sanierungsziele gerade hiermit befördert. Mit diesen Ergebnissen setzen sich die Ausgleichsbetragsermittlungen der Verwaltung nicht auseinander.
7. Ansatz von Ertragsminderungen durch Mietbindungen und –obergrenzen
In den Sanierungsgebieten bzw. den Bescheiden zur Sanierungsgenehmigung sind vielfach Mietobergrenzen festgesetzt. Die Gestaltungen hierzu sind angesichts der rechtlichen Fragwürdigkeiten einerseits und dem unbedingten Willen der Bezirksämter andererseits mannigfaltig. Jedenfalls kommt es häufig zu einer faktischen Begrenzung der zulässigen Erträge. Dies ist m. E. eine klar „sanierungsbedingte„ Einschränkung, die auf den Bodenwert durchschlägt. Es erscheint vertretbar, eine sanierungsbedingte Wertminderung wie folgt zu berechnen:
Marktüblicher Mietertrag – Sanierungsbedingte „Bindungsmiete„ = Minderertrag
Die Summe der Mindererträge – die in künftigen Jahren dabei abgezinst – ergibt die sanierungsbedingte Wertminderung für das Grundstück.
Die Minderung für künftige Jahre ergibt sich entweder aus vertraglich/durch Bescheid festgelegten fortgeschriebenen Bindungsmieten oder durch eine Fortschreibung der gebundenen Ausgangsmieten mit dem allgemeinen Mietrecht (20 % Erhöhung alle 3 Jahre) und läuft somit zu einem benennbaren Zeitpunkt aus.
In der allgemeinen Wertermittlungspraxis (z.B. bei gerichtlichen Verkehrswertgutachten in Zwangsversteigerungsverfahren für preisgebundene Objekte, bei denen es für eine gewisse Zeit zu Fortwirkungen einer Mietpreisbindung kommt) ist dies ein übliches Verfahren und es erscheint lohnend, diesen Ansatz zu verfolgen, da die einnahmenbeschränkende Praxis der Mietobergrenzen nicht ohne Relevanz für die Frage sein kann, welchen abzuschöpfenden „Vorteil„ der Eigentümer aus einer Sanierungsmaßnahme hat.
8. „rb„ – der „rentierliche Bodenwertfaktor„ im Berliner Modell
Davon zu unterscheiden ist i. ü. das allgemeine Verfahren, nachdem die Berliner Verwaltung gewissermaßen einen prozentualen Nachlaß auf den Ausgleichsbetrag gibt, wenn die aufstehende Bebauung den rentierlichen Anteil der Bodenwerterhöhung mindert. Der Ausgleichsbetrag wird dazu mit dem „rentierlichen Bodenwertanteil„ („rb„) multipliziert, soweit dieser kleiner 1 ist, was zu einer entsprechenden Reduktion führt. Diese Praxis ist seitens der Verwaltungsgerichte in Zweifel gezogen worden, da sich im Gesetz keine Stütze für die Berücksichtigung der aufstehenden Bebauung für die Ermittlung des Ausgleichsbetrags finde. Nach diesseitiger Ansicht bedarf es einer solchen Stütze aber nicht um „rb„ weiter anzuwenden. Denn es muß sich nicht um einen (im Gesetz nicht vorgesehenen) Rechenschritt zur Ermittlung der Bodenwerterhöhung handeln, sondern man kann „rb„ auch als standardisiertes (Teil)erlaßverfahren ansehen: § 155 Abs. 3 und 4 BauGB geben der Behörde das Recht, von einer Erhebung des Ausgleichsbetrags im öffentlichen Interesse (teilweise) abzusehen. Ein solches öffentliches Interesse kann auch das Anliegen sein, Eigentümer bebauter und meist zu Mietshauszwecken genutzter Grundstücke nicht weiter zu überfordern, um ein weiteres Anwachsen von Zwangsversteigerungen und Mietsteigerungen zu verhindern. Diese politische Verzichtsentscheidung ist auch dann zu akzeptieren, wenn sie verfahrenstechnisch mit der Wertermittlung verknüpft erscheint, da es der Verwaltung offen steht, den Trennschnitt zwischen Betragsermittlung und Betragsfestsetzung zu definieren.
9. Fazit
Eine „sanierungsbedingte„ finanziell positive Entwicklung in den Sanierungsgebieten ist vielfach nicht auszumachen. Bedingt durch „soziale Sanierungsziele„ bleiben die Gebiete hinter ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten zurück. Die Bewertung „sanierungsbedingt„ der Verwaltung unterliegt jedenfalls in vollem Umfang gerichtlicher Kontrolle und es ist daher zu hoffen, daß das Berliner Verwaltungsgericht der Behauptung, im Ostteil Berlins gebe es keine „allgemeine positive Entwicklung von 1990 – 2010„ ein Ende setzt. Mit Krautzberger (Battis/Krautzberger BauGB 6. A. § 142 Rn. 36) sei klargestellt: „Ist nicht die Umstrukturierung eines Gebietes beabsichtigt, sondern in erster Linie die Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung vorhandener baulicher Anlagen, sind erfahrungsgemäß Bodenwertsteigerungen nicht zu erwarten…„.
III. Problematische Tendenz der Verwaltungsgerichte zur Neufestsetzung durch Gutachten
Dem Betroffenen, der sich angesichts oben dargestellter Fragwürdigkeiten hilfesuchend an die Verwaltungsgerichtsbarkeit wendet, droht weiteres Ungemach: Wegen der Komplexität der Wertermittlungsfragen tendieren die Gerichte dazu, sich völlig von einer rechtlichen Beurteilung der konkret durch die Anfechtungsklage angegriffenen Bescheide zu lösen und statt dessen ein Gutachten zur Ermittlung des korrekten Ausgleichsbetrags in Auftrag zu geben. Statt wie in § 113 Abs. 1 VwGO als Regelfall vorgesehen, schlicht die Rechtswidrigkeit des angegriffenen Bescheids über den Ausgleichsbetrag festzustellen und diesen aufzuheben, wird er (mit anderer Begründung, nämlich mit dem eingeholten Gutachten) (teilweise) aufrecht erhalten. Ist nun der festgesetzte Ausgleichsbetrag relativ gering und – wenn auch deutlich übersetzt – so doch vielleicht zu einem kleineren Teil berechtigt, droht dem betroffenen Kläger, einen Teil der (hohen) Kosten eines solchen Gutachtens tragen zu müssen. Er steht vor der Alternative, entweder die offenkundig rechtswidrige Berechnung der Verwaltung zu akzeptieren, oder sie (teilweise) auf seine Kosten durch die Berechnung eines gerichtlich bestellten Gutachters ersetzen zu lassen.
Ein solches Vorgehen ist nach diesseitiger Auffassung rechtsfehlerhaft: Zwar normiert § 113 Abs. 2 S. 1 VwGO die Möglichkeit einer Neufestsetzung durch das Gericht bei auf Geldleistung gerichteten Bescheiden. Doch kann das Gericht im Ergebnis nicht einen VA schaffen, dessen tragende Begründung die Behörde selbst im Prozeß nicht hätte nachholen können (Kopp/Schenke § 113 VwGo Rn. 153 unter Verweis auf Müller, NJW 1978, 1357; vgl. auch BVerwG 69, 92). Bei einem Sanierungsausgleichsbetrag fehlt auch jeder Aspekt einer Eilbedürftigkeit, der in BVerwG 69, 91 zu einem anderen Ergebnis führte. Anders als in den bisher zu Gunsten einer Abänderungsbefugnis mit neuer Berechnung (statt reiner Kassationsbefugnis) entschiedenen Fällen handelt es sich auch nicht um eine eigene – durch die Gerichtsgebühren abgedeckte – Rechenarbeit des Gerichts, sondern um eine teure externe Gutachterleistung, die wirtschaftlich gesehen (Teilkostenlast aus den hohen Gutachterkosten) den Rechtsschutz des Betroffenen einschränkt.
Vor allem aber liegt mit Begriffen des allgemeinen Verwaltungsrechts gesprochen letztlich ein Problem des sogenannten „Nachschiebens von Gründen„ im Verwaltungsprozeß vor. Der erlassene Verwaltungsakt (Ausgleichsbetrag) soll nach Klageerhebung des Beschwerten auf eine ganz andere Begründung gestützt werden. Nach der wohl herrschenden Meinung (vgl. Kopp/Schenke § 113 VwGO Rn. 63 ff.) ist dieses Nachschieben zwar grundsätzlich zulässig. Bei Ausgleichsbetrags-Bescheiden aber handelt es sich jedenfalls um Verwaltungsakte mit Beurteilungsspielraum. Denn zumindest hinsichtlich der Wertung/Gewichtung der einzelnen Kriterien (In Berlin im „Zielbaum„ manifestiert) besteht (s. o.) ein Beurteilungsspielraum der Behörde. Damit sind sie Ermessensverwaltungsakten bereits gleichzusetzen. Zudem liegt auch ein eigentlicher Ermessensspielraum vor: Die oben angesprochenen allgemein gewährten „Nachlässe„ auf den Ausgleichsbetrag, wie die Berücksichtigung nur des „rentierlichen Anteils„ („rb„) bei aufstehenden Bebauung, sind praktischer Ausfluß dieses Ermessensanteils. Die Vorschriften des § 155 Abs. 3 und IV BauGB geben der entscheidenden Behörde ja auch das Recht, von der Erhebung des Ausgleichsbetrags abzusehen oder einen Teilerlaß zu gewähren. § 155 Abs. 3 erlaubt eine entsprechende Entscheidung für das ganze Sanierungsgebiet oder Teile davon, § 155 IV normiert ein Ermessen im Einzelfall. Jedenfalls letzteres kann aber erst dann vollständig und fehlerfrei ausgeübt werden, wenn die Höhe des in Rede stehenden Betrages korrekt ermittelt ist bzw. feststeht. Denn erst wenn man die Höhe des Anspruchs kennt, über dessen Einhebung man ermessensfehlerfrei zu entscheiden hat, kennt man die richtige Entscheidungsgrundlage.
Bei VA mit Ermessens- oder Beurteilungsspielraum kommt eine Abänderung gem. § 113 Abs. 2 S. 1 VwGO aber nicht in Betracht (BVerwG 32, 50; 33, 353; 38, 310; 44, 22; 69, 91; DÖV 1970, 646 u.a.; Kopp/Schenke § 113 VwGO Rn 152 m.w.N.).
Eine Entscheidung durch das Gericht, die bei völlig fehlerhafter Berechnung über eine Aufhebung des fehlerhaften Bescheids oder eine Teilrückverweisung nach § 113 Abs. 2 S. 2 VwGO hinausgeht, nimmt dem jeweiligen Kläger die Ermessensinstanz. Dem Gericht ist ein Nachschieben von Gründen in Form eines komplett neuen/anderen Gutachtens nach Auffassung des Verfassers auch deshalb untersagt, weil es dadurch seinen Beurteilungsspielraum bzw. den Beurteilungsspielraum des gerichtlich bestellten Gutachters unter Verstoß gegen das Gewaltenteilungsprinzip und § 114 VwGO an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzte und einen neuen VA erließe. Dies führte zugleich zu einem Verstoß gegen den Gleichheitssatz. Denn da wie oben gezeigt z.B. die Berücksichtigung von „rb„ jedenfalls als teilweises Absehen von der Erhebung im öffentlichen Interesse zulässig ist, verlangt der betreffende Kläger, wenn er (anders als vielleicht ein Gutachter) dies zu berücksichtigen fordert, keine „Gleichbehandlung im Unrecht„, sondern eine ganz normale rechtliche und tatsächliche Gleichbehandlung. Wird statt dessen durch ein gerichtlich bestelltes Gutachten ohne „rb„ festgesetzt, so liegt eine gleichheitswidrige Behandlung vor.
Eine Neufestsetzung nach Gerichtsgutachten übersieht zudem, daß es grundlegende Pflicht der Verwaltung ist, auf ihre Kosten eine korrekte Ermittlung zu erstellen oder erstellen zu lassen. Diese Pflicht darf nicht – auch nicht teilweise – wirtschaftlich beim Betroffenen abgeladen werden. Daher kommt nach Auffassung des Verfassers in all jenen Fällen, in denen der angegriffene Ausgleichsbetrags-Bescheid nicht nur an geringfügigen Mängeln oder Fehleinschätzungen leidet, sondern so fundamental rechtswidrig ist wie oben beschrieben, nur eine Aufhebung bzw. eine „Teilrückverweisung„ nach § 113 Abs. 2 S. 2 VwGO in Betracht. Nur wenn es um einzelne, wenige Fehler (etwa eine falsche Einordnung einzelner Zustände im Bewertungsrahmen zum Zielbaumschema) ginge, die innerhalb des von der Behörde im Bescheid vorgegebenen Systems und Bewertungsschemas korrigiert werden könnten, kämme eine entsprechende Ermittlung durch das Gericht und eine Modifikation des Ausgleichsbetrags auf eine geringere Summe in Betracht.
In jeder Ausgabe des GRUNDEIGENTUM finden Sie interessante mietrechtliche Gerichtsentscheidungen, Aufsätze, Hintergrundinformationen, Gesetze und Verordnungen sowie wertvolle Praxistips rund um die Grundstücks-, Haus- und Wohnungswirtschaft.
Informieren Sie sich schon vorab im Inhaltsverzeichnis des aktuellen GRUNDEIGENTUM-Heftes, das wir Ihnen im DOWNLOAD-Bereich als PDF-Datei zur Verfügung stellen, über die jeweiligen Inhalte bzw. Themenschwerpunkte!
Autor: Dipl. Kfm. Peter Kreilinger, Rechtsreferendar, Regensburg